2019 – 2020: Neue Räume / Neue Perspektiven

Tammam Azzam, Tewa Barnosa, Ammar Al-Beik, Jeanno Gaussi, Ala‘ Hamameh, Yara Said, Abdul Razzak Shaballout, Huda Takriti und Mohammad Zaza liessen uns mit den von ihnen gewählten Bildsprachen und Blickwinkeln an ihrer Auseinandersetzung mit den erlebten Umbrüchen teilhaben. Ihre Werke beleuchten persönliche und historische Erinnerungen, fragen nach Zugehörigkeit und reflektieren die gewonnene Freiheit, sich ohne Repressionen ausdrücken zu können. Wie übersetzen die Künstler*innen diese existenziellen Erfahrungen in ihr Werk?
Kuratiert wurde die Ausstellung von unserer Kollegin Dr. Maritta Iseler. Hier spricht sie in einem Interview des Magazins AufRuhr der Stiftung Mercator über die Hintergründe
Hier können Sie die Broschüre zur Ausstellung herunterladen.
Weiterhin hatten wir im Rahmen der Ausstellung einen Gesprächsabend mit der Stiftung Mercator geplant. Unter dem Titel „Who am I here? Über das Leben und Arbeiten von Künstler*innen im Exil.“ wollten wir im Mercator Salon gemeinsam mit der Dokumentarfilmerin Reem Karssli, dem bildenden Künstler Ali Kaaf und dem Lyriker über das Arbeiten und Sein in der Diaspora sprechen. Dieses Gespräch musste auf Grund der Corona-Kontaktsperre leider entfallen.

Gibt es ein Leben nach dem Tod?
In dieser Reihe öffnen Buchhandlungen in ganz Deutschland ihre Räume, um Begegnungen zwischen Newcomern und der Nachbarschaft zu ermöglichen. Die Buchhändler gewinnen mit KundInnen zusammen Newcomer, die ihre Geschichte erzählen oder aus einem ihrer Lieblingsbücher vorlesen.
Text: Annika Reich
Foto: Dominik Butzmann

Jörg Braunsdorf, der Inhaber der Tucholsky Buchhandlung, ließ sich sofort für die Idee begeistern und hatte schnell einen Kunden gefunden, der die Organisation übernahm. Der Regisseur Frank Alva Buecheler ist hochengagiert in der Flüchtlingshilfe, hat in einem Heim in der Nachbarschaft geholfen, bis er zwei Organisationen gründete, die sich um geflohene Menschen kümmern und Auftritte für geflohene Künstler und Musiker organisieren (freedomus und freeartus).
Zu unserem Premierenabend brachte er einen Mann aus Pakistan mit, den er in dem Heim kennengelernt hatte und der nun seit einem Jahr in Berlin lebt. Der Pakistani war ihm aufgefallen, weil er abseits der Anderen im Aufenthaltsraum saß und ohne Unterlass schrieb. Ein Buch über seine Erfahrungen wolle er schreiben, fand Buecheler heraus und besorgte ihm einen Literaturagenten. Außerdem fand er einen jungen Syrer, der das Englische des Pakistani ins Arabische übersetzte und dies grandios meisterte, wie mir eine befreundete palästinensische Autorin bestätigte.

Die Tucholsky Buchhandlung platzte aus allen Nähten. Als der Übersetzer anfangs fragte, ob es im Publikum Menschen gebe, die nur Arabisch sprächen, schnellten die Arme hoch. Es war uns also gelungen, nicht nur Kunden der Buchhandlung, sondern auch viele Newcomer in die Buchhandlung zu locken.
Der Pakistani erzählte von seiner Flucht, seinen traumatischen Erfahrungen in Pakistan, den Schuldgefühlen seiner Familie gegenüber und wie wenig er sich noch vor zehn Jahren vorstellen konnte, dass sein Leben so verlaufen würde. Aus Angst davor, dass seiner Familie weiteres Leid geschehen könne, falls jemand erführe, dass er in Deutschland ist, bat er darum, keine Details seiner Erzählungen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Aus diesem Grund nenne ich seinen Namen nicht und nenne ich auch keine weiteren Details aus seiner Lebensgeschichte.
Im Laufe des Abends meldeten sich zahlreiche Männer aus dem Irak, aus Palästina und Syrien und eine pakistanisch-stämmige Deutsche zu Wort, befragten den Pakistani und sprangen dem Übersetzer zur Seite, der teilweise sehr lange Passagen zu übersetzen hatte.
Im Nachhinein denke ich, ich hätte diese Menschen noch viel mehr miteinbeziehen sollen. Die Frage, die ich dem Pakistani eingangs gestellt hatte: „Welche Szenen sind dir seit deiner Ankunft in Deutschland am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben?“, diese Frage hätte ich der Runde stellen sollen. Eine Idee für das nächste Mal.
Nachdem der Pakistani Adressen mit KundInnen ausgetauscht hatte, die ihm bei der Jobsuche helfen wollten, und wir uns alle bei Wein und Wasser weiter in kleineren Gruppen unterhalten hatten, gingen wir noch mit einigen Besuchern in die Kneipe nebenan. Ich saß etwas erschöpft von meiner Moderation neben einem jungen Mann aus dem Nordirak. Er verstand weder Deutsch noch Englisch, aber zückte wort- und tonlos sein Smartphone und tippte in seine Übersetzungsapp: „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“
Ich musste lachen, sagte ihm, dass das für den Einstieg eine ziemlich philosophische Frage sei, und warum er das wissen wolle. Ein Syrer, der neben uns saß, übersetzte. Der junge Mann verzog keine Miene, sondern tippte: „Mein Leben ist zu Ende.“
Ich schwieg. Und als ich mein eigenes Schweigen nicht mehr aushielt, fragte ich ihn, was er beruflich mache.
„Gitarrist“.
Seine Fingernägel, die waren mir schon aufgefallen.
Dann tippte er wieder: „Mein Vater ist Professor für Keramik und Bildhauerei, ein Bruder ist Bildhauer, ein Bruder ist Kalligraph. Willst Du Bilder von meinen Brüdern sehen?“
Ich nickte.
Er tippte: „Ja?“ und schaute mich fragend an.
Ich verstand nicht und nickte wieder.
Dann scrollte er sich durch seine Fotosammlung und zeigte mir ein Bild von einem Arm, vom Oberarm bis zum Handgelenk aufgeschlitzt und ein Bild von einem Bauch, von Folterspuren übersät.
Es sind all diese Geschichten, von denen ich nicht weiß, wie ich sie verkraften soll, und es sind diese Geschichten, die mir zeigen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen.
Begegnungsort Buchhandlung in Pullach
Erzählsalon und Lesung in der Charlotte-Dessecker-Bücherei am 1. März 2016 mit Jürgen Bulla, Sandra Hoffmann, Katja Huber, Margarete Moulin, Steven Uhly und Andreas Unger.
Text: Fridolin Schley

Etwa fünfzig Gäste, die meisten aus der Umgebung, kamen ins Pullacher Bürgerhaus, um einen Abend zu erleben, der aus ganz unterschiedlichen Perspektiven um das Phänomen des Fremden kreiste und dieses in ein konkretes Kennenlernen überzuführen versuchte. Denn die sechs Münchner Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vor allem Beiträge aus einer gemeinsamen Anthologie gegen Fremdenfeindlichkeit lasen, wechselten sich mit vier geflüchteten jungen Männern aus Syrien und dem Senegal ab, die über ihre Flucht, ihren Aufenthalt in Deutschland und ihre Pläne für die Zukunft berichteten. Im Publikum saßen weitere syrische Flüchtlinge, die derzeit in einer Massenunterkunft in München leben und nach Pullach gekommen waren, um, wie ihr ‚Flüchtlingshelfer‘ sagte, „einmal zu sehen, dass es in der Gesellschaft noch andere Zugänge zu ihren Situationen gibt“, als es sich ihnen momentan über die Medien oft darstelle. Natürlich schwebte unweigerlich das jüngste Gewaltgeschehen aus Clausnitz und Bautzen über dem ‚Begegnungsort‘ – und die neueste Statistik, wonach es schon 2015 fast 1000 Angriffe gegen Flüchtlinge oder ihre Unterkünfte gegeben hat. Im Schnitt drei am Tag.
Aus meiner Sicht wurde es eine vielseitige, intensive, aber manchmal auch schwierige Begegnung. Wahrscheinlich war meine Vorstellung von vorneherein naiv gewesen, dass man Menschen aus drei so unterschiedlichen Ländern und Kulturen, mit ihren ganz verschiedenen Erfahrungen, Verletzungen und Erwartungen nur an einem solch bildungsbürgerlich getränkten Ort zusammenbringen und diesen mit behutsamen literarischen Annäherungen federn müsse, und schon wachse in Austausch und Wohlgefallen zusammen, was in der gesellschaftlichen Integrationsrealität oft durch vielfältige Schwierigkeiten getrennt ist. Diese beginnen ja schon bei der sprachlichen Verständigung, und das machte der Abend manchmal spürbarer, als es geplant oder für die Teilnehmer und Anwesenden, naja, angenehm war. Aber soll und darf das der Anspruch sein? Eine gefällige Performance?
In den meisten Momenten schienen die Texte und Gespräche zu fruchten, auch das Publikum stellte Fragen, sparte Heikles nicht aus – wie die fast schon obligatorische Schleierthematik, die Rolle und Zukunft des syrischen Diktators Assad oder die mitunter vernachlässigte Rolle der Ehefrauen bei der Integration der geflohenen Familien. Glatter Gleichklang stellte sich so nicht ein. Es gab immer wieder auch Missverstehen, Augenblicke der Hemmung und des bedrückten Schweigens. Doch ich glaube, genau das müssen wir lernen, auszuhalten. Denn so funktioniert Kennenlernen, an einem einzelnen Abend wie diesem, aber vor allem an den tiefer fassenden gesellschaftlichen Graswurzeln, im Alltag der Gemeinden und Kommunen.
Die anwesenden Autorinnen und Autoren waren Jürgen Bulla, Sandra Hoffmann, Katja Huber, Margarete Moulin, Steven Uhly und Andreas Unger. Sie lasen mal lyrische Texte über das Fremde, mal essayistische Reflexionen über verschiedene Ausprägungen des Rassismus oder betrieben einen humorvoll-subversiven Indizienprozess gegen die eigenen Gedanken, gegen den „Pegiden in mir“. Die Journalistin Margarete Moulin, die seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert ist, berichtete über einen konkreten von ihr betreuten Fall drohender Abschiebung.
Nach jeweils zwei Texten setzten sich die Geflohenen dazu, zunächst Jamal Aloudtallah und Diaa Saleh, beide aus der syrischen Hauptstadt Damaskus. Vor gut einem Jahr kamen sie nach Deutschland, nach zäher, fünfmonatiger Flucht, zunächst allein, später konnten sie ihre Familien nachholen. Man habe sie hier sehr offen aufgenommen, erzählten sie, und nein, von der drastischen Verschärfung der Stimmung gegen Flüchtlinge wüssten sie eigentlich nur aus den Medien, nicht aus eigener Erfahrung. Mit jeder Frage öffneten sie sich nun ihrerseits mehr, verloren rasch die Scheu vor der Bühne und berichteten in erstaunlich fließendem Deutsch von ihren Kindern, von den Wohnungen, die sie nun bezogen haben, und von ihren Berufen. Nur als die Frage auf die Zukunft Syriens kam, auf die Rolle Assads, entschuldigten sie sich, über den syrischen Krieg würden sie sich lieber nicht äußern, schon weil sie noch Verwandte und Freunde dort hätten, die sie nicht gefährden wollten. Da war die Bedrohung des Krieges plötzlich doch sehr anwesend, mitten in dieser oberbayerischen Gemeinde. Bei aller – wie soll man das sagen? – bewundernswerter Mustergültigkeit ihres Auftretens und ihrer Integration klang hier eine Dringlichkeit an, die dem harmonischen Miteinander als wichtiges Korrektiv diente: Den beiden und ihren Familien scheint es gut zu gehen. Aber damit ist noch lange nicht alles gut. Und nicht nur, weil noch immer Krieg herrscht. Auch ihre Berufe vermissen sie sehr, Jamal Aloudtallah etwa ist Anästhesist. Sie wollen wieder arbeiten, richtig arbeiten, ihren Ausbildungen angemessen. Das wurde als ihr größter Wunsch für die kommende Zeit deutlich – zusammen mit ihrem Optimismus, ihrer Hoffnung. Die bürokratischen Verfahren für eine Arbeitsberechtigung laufen.
Was sich bei den beiden Syrern mehr zwischen den Zeilen andeutete – all die zermürbende Unsicherheit, die traumatischen Erfahrungen, die Härten in der Fremde, die Sehnsucht nach dem Vertrauten – wurde im zweiten Gespräch mit Abdoulaye D. und Souley S. fast schmerzlich greifbar. Wie hoch allein schon die Hürden der Mitteilung, des Verstehens und Verstandenwerdens für sie sein müssen – und das die ganze Zeit – deutete sich an, als Abdoulaye D. gleich zu Beginn sagte, er könne dem Abend sprachlich leider kaum folgen – und ich ihn dabei nun meinerseits mehrfach nicht verstand. Meine Kolleginnen und Kollegen mussten mir zu Hilfe springen. Ein beklemmendes Gefühl. Wie muss es ihm da erst gehen? Jeden Tag. Dass er, von der exponierten Bühnensituation zusätzlich verunsichert, leise und stockend sprach, spürbar Distanz wahrte zu Mikrophon und Publikum, aus dem es bald „Lauter, lauter!“ tönte, verstärkte das Dilemma noch.
Wahrscheinlich wären hier längere Vorgespräche meinerseits und ein genaueres Vorbereiten auf den Ablauf nötig und besser gewesen (oder gleich eine offenere, nicht so frontale Sitzanordnung); so übertrug sich vor allem Abdoulaye D.s Unwohlsein. Doch je mehr er sich – nach und nach – verständlich machen konnte, einmal auch mit Hilfe seiner anwesenden Sprachlehrerin, desto augenfälliger wurde, dass sich jenes Unwohlsein eben nicht nur auf seine Position an diesem Abend bezog, sondern auf seine Gesamtsituation: So sehr er auch versuche, die deutsche Sprache zu lernen, betonte er immer wieder, und so dankbar er Menschen wie seiner Lehrerin sei, so schwierig bleibe es doch, so groß die Distanz zur Gesellschaft. Es geht ihm einfach nicht gut hier. Seine Familie ist noch in der Heimat, seine Tochter hat er seit sechs Jahren nicht gesehen. Nun möchte er Geld für eine Werkstatt sammeln und freiwillig zurückgehen – wohl auch, um einer Abschiebung zuvorzukommen. Denn Senegal gilt offiziell als sicher.
Wie realitätsfremd diese Einstufungen oft sind (die Schriftstellerin Sandra Hoffmann wusste später Ähnliches von ihrer Reise nach Albanien zu berichten), erschloss sich spätestens, als der zweite senegalesische Flüchtling Souley S. von der Ermordung seines Vaters zu Hause erzählte. In Ländern wie dem Senegal herrschen oft blutige Konflikte zwischen Clans; in die gängigen Muster von Diktatur, islamistischem Terror oder Bürgerkrieg passt das mitunter nicht – aber das macht sie noch lange nicht zu ‚sicheren Herkunftsländern‘.
Darf man jemanden wie Souley S. überhaupt nach seiner Flucht fragen? Ich bin mir im Nachgang nicht mehr so sicher. Zu verfolgt vom Grauen schien er noch zu sein, als er zögerlich zu antworten begann. Aber: er berichtete trotzdem, leise und ausführlich, auf Französisch und Stück für Stück übersetzt von der Journalistin Margarete Moulin, die spontan und so klar wie einfühlsam assistierte – berichtete von der langen Reise, den Schleusern und den Booten. Den Schrecken selbst musste er dabei nicht in Worte fassen; er war ihm ins Gesicht und auf die Stimme geschrieben.
Den Abschluss, bevor sich Publikum und alle Beteiligten zu einem kleinen ‚Empfang‘ versammelten und zu neuen Gesprächen mischten – die Bücherei hatte großzügig für Essen und Trinken gesorgt –, bildete die Geschichte Fremdkörper von Sandra Hoffmann, in der sie sich an Orhan erinnert, einen türkischen Kindheitsfreund und Gastarbeitersohn mitten auf dem spießigen schwäbischen Land der frühen Siebzigerjahre. Daran, wie er ihr als Kind irgendwann ganz selbstverständlich vertraut geworden war, allein schon dadurch, dass sie beide da waren, dass sie das Dorf, die Schule, die Orte teilten und sich dort begegneten. „Es war also, als ich vier Jahre alt war, als mein Körper so ganz nebenbei den Körper eines türkischen Jungen kennengelernt hat. Orhan Kutlucan pinkelte auf der gleichen Kindertoilette wie ich, und Schwester Soteris schlug ihm mit dem Kehrwisch genauso den Arsch voll wie mir, wenn er Schimpfworte sagte.“ Und sie glaube, so lautet der letzte Satz, dass in Sachen Offenheit gegenüber dem Fremden manchmal der eigene Körper längst mehr weiß als der Kopf. Dass der Kopf vom Körper lernen kann.
Die erste arabisch-deutsche Kinderlesung in der Berliner Tucholsky Buchhandlung
Kaum hatte ich die Gummibärchen gegen die Kekse und Datteln ausgetauscht, rauschte sie schon mit einer Schar Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in den Laden.

Wir wussten nicht, wer kommen würde und wie viele. Wir wussten nicht, ob unsere arabischen Plakate in den Heimen der Nachbarschaft die Eltern erreicht hatten. Wir wussten nicht, ob sich die syrischen und irakischen Eltern mit ihren Kindern auf den Weg machen würden – in eine Buchhandlung, die sie nicht kennen. Wir wussten von einigen Kundinnen und Kunden, dass sie mit ihren Kindern vorbeischauen wollten. Das war’s. Wir haben also erst einmal nur 20 Stühle gestellt. Eine halbe Stunde vor Beginn funktionierte der Beamer für das Bilderbuchkino nicht, und uns fiel ein, dass in Gummibärchen Schweinegelatine ist.
Ich lief also zurück nach Hause, räumte unseren Süßigkeitenschrank leer und kam mit Keksen und Datteln zurück. Als ich den Laden betrat, hatte der palästinensische Kameramann, der an diesem Sonntagnachmittag übersetzen sollte, den Beamer zum Laufen gebracht, und der syrische Lehrer, der eine der Geschichten vorlesen sollte, war auch schon da. Er war zwar etwas erstaunt, dass es gleich losgehen sollte, denn er dachte, dass er erst einmal zu einer weiteren Vorbesprechung gekommen war, aber er lachte, blätterte durch das Buch und sagte: Kein Problem.
Eine Kundin hatte mir vormittags noch am Telefon gesagt, dass sie einfach in die Notunterkunft um die Ecke fahren würde, in der sie wöchentlich mit den Kindern spiele, und alle Kinder in ein Großraumtaxi setzen, die zur Lesung mitkommen wollten. Anders funktioniere das meist nicht so gut. Spontan sei am besten, und viele Kinder langweilten sich in den Heimen sowieso. Kaum hatte ich die Gummibärchen gegen die Kekse und Datteln ausgetauscht, rauschte sie schon mit einer Schar Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in den Laden.
Esra Al Heale, die junge, schwangere Mathematiklehrerin aus Mossul hatte ein rotes geblümtes Kleid an, sah wunderschön aus und hatte diesen humorvollen Blick, den ich an ihr so mochte. Ihr Mann Radwan begann mit dem Buchhändler Jörg Braunsdorf mehr und mehr Stühle aus dem Kabuff hinter dem Laden nach vorne zu tragen. Die Buchhandlung füllte sich so schnell, dass wir den Teppich aus dem hinteren Bereich vor der Leinwand ausrollten und Kissen auf dem Boden verteilten. Die Kekse waren weg, bevor die letzten Gäste eingetroffen waren. Es waren dreimal so viele Menschen gekommen wie wir gedacht hatten.
Katja Schreiber, Drehbuchautorin, las mit ihrer tiefen Stimme im Wechsel mit Tameem Mhanna, dem syrischen Lehrer »Sonne und Mond: Wie aus Feinden Freunde wurden«, ein zweisprachiges Märchenbuch aus der Edition Orient des berühmten ägyptischen Illustrators Ihab Schakir vor. Die Originalausgabe wurde in Ägypten mit dem höchsten Staatspreis für Kinderliteratur ausgezeichnet. Den Kindern war das egal, sie staunten die Bilder an und hörten gebannt zu, denn in der Geschichte krachte es gewaltig.
Nach einer kurzen Pause, in der es nur noch Datteln und Saft gab und noch mehr Familien eintrudelten, ging es mit dem sehr lustigen Buch von Rania Zaghir und Racelle Ishak weiter: „Wer hat mein Eis gegessen?“
Stefan Trudewind, der Verleger der Edition Orient fragte die Kinder, was Eis auf Arabisch heiße. Dann bat er die deutschen Kinder während des Zuhörens bei dem Wort „Busa“ die Finger hochzustrecken und die arabischen bei dem Wort „Eis“. Das machte allen Spaß. Nächstes Mal würde ich so etwas bei allen Geschichten machen.
Tanja Székessy, Illustratorin und selbst Kinderbuchautorin, las die deutsche Version mit verstellten Stimmen und Esra schmunzelte, während sie die arabische las.
Mein Mann lief nach der letzten Zeile der Eis-Geschichte zum Cafè nebenan und kam mit Schokoladencroissants zurück, die nach eineinhalb Minuten auch schon wieder aufgegessen waren.
Viel schöner kann ein solcher Nachmittag nicht sein. Und es war so einfach. Ich werde „Busa“, das arabische Wort für Eis nie vergessen und alles beim nächsten Mal wieder genau so machen – nur Kekse gibt es dann fünfmal so viele.
Aus diesen Büchern wurde vorgelesen:
Samira Schafik: „Sonne und Mond: Wie aus Feinden Freunde wurden“, illustriert von Ihab Schakir, aus dem Arabischen von Petra Dünges, zweisprachig Arabisch/Deutsch, Edition Orient, Berlin, ISBN 978-3-922825-89-0, 32 Seiten.
Rania Zaghir: „Wer hat mein Eis gegessen?“, illustriert von Racelle Ishak, aus dem Arabischen von Petra Dünges, zweisprachig Arabisch/Deutsch, Edition Orient, Berlin, ISBN 978-3-945506-02-8, 20 Seiten.
Freimütig und poetisch – geflohene und einheimische Jugendliche erzählen von ihren Sehnsüchten
Im Theater Morgenstern in Berlin-Friedenau sprechen Jugendliche aus Afghanistan, Syrien, Albanien und Deutschland miteinander über ihre Geschichten, ihre Situation, ihre Sehnsüchte.

Es war ein sehr bewegender und toller Samstag. Wir hatten vom ersten Moment an ein volles Haus. Das Interesse der Menschen in Friedenau war sehr groß, die Neuangekommenen kennenzulernen. Und es waren tatsächlich einige Bewohner der Unterkunft im Rathaus zum Teil sogar den ganzen Tag über da. Das war schön. Abends spielten zwei afghanische Musiker vor Ort Livemusik, die afghanischen Jugendlichen haben sofort angefangen zu tanzen und konnten die Friedenauer mit ihrer Lebenslust anstecken.
Aufgrund des großen Andrangs haben wir den Gesprächssalon aus dem geplanten kleineren Raum in den Theatersaal verlegt. Beim nächsten Mal würde ich das – glaube ich – nicht mehr so machen. Zumindest nicht mit Jugendlichen. Ein intimerer Rahmen passt einfach besser. Auch würde ich mehr Zeit einplanen oder die Teilnehmerzahl noch verkleinern. Ich hätte gerne von jedem Einzelnen noch mehr gehört, insbesondere von der Lebensfreude und dem ehemals lebendigen Treiben in Aleppo. Davon hat ein syrischer Jugendlicher erzählt. Sein Text war von großer Dichte und Poesie. Unglaublich auch die Geschichte eines afghanischen Jungen. Er erzählte, wie er ganz alleine unterwegs war und zu Fuß von Griechenland bis nach Deutschland gelaufen ist. Die Veranstaltung fand auf Deutsch, Farsi und Arabisch statt.
Der Berliner Autor Florian Werner moderierte den Erzählsalon mit Sensibilität und Bedacht, was eine große Bereicherung war. Nächstes Mal erweitern wir das Gespräch und öffnen es auch für die Zuhörenden. Da wir so viele Geschichten gehört hatten, blieb zu wenig Zeit für Fragen.
Wir möchten dieses Format regelmäßig durchführen, sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen z.B. direkt aus der Unterkunft im Rathaus, so dass die Friedenauer*innen konkret die Möglichkeit haben, die Menschen und ihre Fähigkeiten kennenzulernen und in einen Austausch zu treten. Wir überlegen ein regelmäßiges Kulturcafé zu etablieren – Hafis’ Salon oder so ähnlich.
Insgesamt war dieser Nachmittag in unserem Theater also ein sehr vielversprechender Anfang. Wir freuen uns auf mehr.
Harte Zeiten, weiche Herzen
Fünfzehn Eindrücke von einem Erzählsalon in der Buchhandlung Thaer in Berlin-Friedenau.

1. „Egoistisch ist nicht, wer darauf besteht, so zu leben, wie er möchte. Egoistisch ist, wer darauf besteht, dass alle so leben, wie er möchte.“ Diese Worte, vorgetragen in einem ruhigen, syrisch eingefärbten Englisch von Ferial Bergli, schallten durch die Buchhandlung Thaer. Sie brachen sich an den Regalen, rollten die Rücken von gebundenen und Taschenbüchern entlang, klangen den Zuhörern in den Ohren und hallten noch lange nach Ende der Veranstaltung in meinem Kopf wider. Diese beiden Sätze markieren ein existenzielles Dilemma: Wie wird man anderen gerecht, ohne sich selbst zu verbiegen? Ein Dilemma, in dem wir alle uns irgendwann wiederfinden, und mit dem manche, seitdem Tausende Neuankömmlinge unter uns leben, heftiger ringen als jemals zuvor.
2. Die Diskussion – kundig geleitet von der palästinensischen Autorin Adania Shibli – bot Einblick in den persönlichen und politischen Werdegang dreier sehr unterschiedlicher Frauen, die dennoch manche Erfahrungen und Ansichten teilten. Katja Ponert vom Team des „Wir machen das“-Rechtsberatungsbusses verbrachte nach dem Abitur ein Jahr in Paraguay und Chile. Es sollte eine prägende Zeit für sie werden. Sie erfuhr, wie ungleich überall auf der Welt Reichtum und Privilegien verteilt sind, und beschloss – in der Überzeugung, dass Ungerechtigkeit mit rechtlichen Mitteln zu bekämpfen sei –, Jura zu studieren.
Zahraa Qais erinnerte sich an bessere Zeiten im Irak: So grauenvoll das Regime Saddam Husseins gewesen sein mag, die Frauenrechte wurden damals doch zumindest in Teilen geachtet. Zahraa ahnte, in welcher Weise Recht und Gesetz das Leben beeinflussen konnten, und wollte daraufhin Anwältin werden.
Ferial gab sich skeptischer und äußerte Zweifel an der Macht des Rechtssystems. In Syrien habe es ihrer Meinung nach immer nur kurze Phasen gegeben, in denen Hoffnung auf Gleichberechtigung der Geschlechter aufkeimte. Trotzdem schaffte sie es, sich als alleinstehende Mutter von drei Kindern ein Leben aufzubauen, indem sie privat Englisch unterrichtete und Geld verdiente.
3. Die Übersetzung ins Englische geriet recht hölzern, und nach einigen Minuten beichtete der Dolmetscher Salem, dass er in letzter Zeit voll und ganz mit Deutschlernen beschäftigt sei und ihm das Umschalten auf Englisch schwer falle. „Könnte ich stattdessen von Arabisch ins Deutsche übersetzen?“, fragte er. Und so wurden wir Zeuge des ungewöhnlichen Moments, in dem jemandem klar wird, dass in seinem Kopf eine Sprache eine andere verdrängt hat, und dass er sich, zumindest hier und jetzt, in der neuen Sprache – die er erst ein knappes Jahr lang spricht – wohler fühlt als in der alten, Englisch, die er sein halbes junges Leben lang gelernt hat.
4. Ferial, die Damaskus verlassen hatte, nachdem ihr Wohnblock bombardiert worden war, verriet uns, dass ihr ursprüngliches Ziel Schweden hieß, dass Deutschland nur eine weitere Station auf dem Weg war. Doch kaum war sie angekommen, wurde sie krank und konnte nicht gleich weiterreisen. Schließlich stellte sie ihren Asylantrag hier. Ihr von mächtigen Kräften – Geopolitik, Religion und Krieg – gelenktes Schicksal wurde plötzlich von einem internationalen Virus bestimmt, der Grippe.
5. Plötzlich meldete sich ein Zuschauer und sagte etwas auf Arabisch. Er frage, erläuterte der Dolmetscher, ob auch die englischen und deutschen Beiträge ins Arabische übersetzt werden könnten, nicht nur anders herum. Dieser kleine Akt der Selbstbehauptung war ein weiteres Anzeichen für den Wandel, in dem unsere Gesellschaft begriffen ist: Es gibt Menschen, die an ihr teilhaben wollen und die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen den Zugang etwas erleichtern. Und so hatten wir, die wir kein Arabisch sprachen, uns zu gedulden und erlebten, was für die Neuankömmlinge eine alltäglich Erfahrung war: Sprache als eine unverständliche Melodie, deren Bedeutung man nur zu gern entziffern würde.
6. „Niemand will sein Land verlassen“, sagte Zahraa. Sie beschrieb die Ängste, denen sie über zehn Jahre lang ausgesetzt war. „Krieg bedeutet Unsicherheit.“ Sie selbst, fügte sie hinzu, hätte damit leben können – und lange Zeit hat sie es ja auch getan. „Ich bin stark, ich bin erwachsen. Ich konnte mich arrangieren.“ Doch alles änderte sich, als sie ein Kind bekam. Ihre Tochter sollte nicht in solch unsicheren Umständen aufwachsen, den Grundfreiheiten beraubt und unter ständiger Bedrohung. Deswegen machte sie sich auf den Weg nach Europa.
7. „Die Jahre weicher Demokratie in Deutschland sind vorbei“, erklärte Katja. Bürger dieses Landes zu sein – so habe ich ihre Aussage verstanden -, ist heute kein Freizeitvergnügen mehr, kein Hobby. Die Zeiten sind vorbei, in denen es ausgereicht hat, über Gleichberechtigung und Chancengleichheit für alle nur zu reden; in denen die beschwerlichste unserer demokratischen Pflichten darin bestand, wählen zu gehen. Die neue Wirklichkeit verlangt eine neue, härtere Haltung. Gefordert ist die Schwerarbeit von öffentlicher Auseinandersetzung, von Protest und Engagement. Es gilt, die Augen auch vor schwierigen Situationen nicht zu verschließen. Die Ellbogen auszufahren und bereit zu sein, all diejenigen unterzuhaken, die eine offene Gesellschaft wollen und sie gegebenenfalls gegen Fremdenfeinde zu verteidigen. Wir leben in Zeiten harter Demokratie, in der unsere Werte ernsthaft auf die Probe gestellt werden.
8. „Wo leben Sie? Wie sieht Ihr Alltag aus? Lernen Sie Deutsch? Sind Sie viel in der Stadt unterwegs? Haben Sie Freunde?“ Das war es, was das Publikum von den Neuankömmlingen als Erstes wissen wollte. „Ich habe viele Freunde!“, lachte Zahraa. Einige davon waren im Publikum. Sie zeigte auf Silke, ihre Englischlehrerin, ihren Mitschüler Saddam aus Pakistan und Hassan aus Aleppo. Auch Ferial hatte Freunde mitgebracht.
Genau genommen erwies sich Freundschaft als Fundament der ganzen Veranstaltung. Ich hatte sie mit meiner Freundin Adania gemeinsam geplant. Zahraa und Ferial hatten zugesagt, weil wir mit ihnen befreundet sind. Katja kam über eine Freundin dazu, die ebenfalls im Rechtsberatungsbus ehrenamtlich tätig ist. Die Buchhändler Elvira und Walther Hanemann richteten den Abend zum Teil deswegen aus, weil wir in Kontakt geblieben sind, nachdem ich vor drei Jahren zu einer Lesung bei ihnen eingeladen war. Mindestens die Hälfte der rund vierzig Zuhörer hatte von der Veranstaltung über Freunde gehört. Freundschaft ist der Nährboden unserer Wurzeln und Zweige. Sie mögen alt oder neu sein, stark oder schwach, doch durch sie sind wir verbunden, sie geben uns Halt und lassen uns wachsen.
9. „Was ist mit all den Neuankömmlingen, die weniger Glück hatten, die hier noch keine Freunde gefunden haben und vielleicht keine finden?“, fragte Magdalene Heuser, eine Zuhörerin. Sie saß neben einem jungen Syrer, der ebenfalls Salem hieß, dem sie privaten Deutschunterricht angeboten hatte, nachdem sie mitbekommen hatte, wie chaotisch und sporadisch die offiziellen Sprachkurse abliefen. Katja seufzte: weder genug Räume noch Lehrer noch Kurse – das sei ein nur zu bekanntes Szenario. Wie soll Integration gelingen, wenn es beim Wesentlichen hakt? Salems Unterricht findet bei Magdalene Heuser zu Hause statt. Er ist Teil ihres Lebens geworden. Jedem, den sie trifft, erzählt sie von ihm. So hat er sich herumgesprochen, so hat er ein Praktikum sowie einen Job in einer Bar gefunden. Mund-zu-Mund-Propaganda. Die uralte Strategie verfehlt ihre Wirkung offenbar auch dann nicht, wenn es um die Unterstützung von Neuankömmlingen geht. Das Publikum in der Buchhandlung jedenfalls ließ sich von Frau Heuser und ihrer Überzeugung mitreißen, dass die Beschäftigung mit Flüchtlingen bereichernd sei.
10. Eine andere Zuhörerin wies darauf hin, dass in Berlin-Friedenau kürzlich zwei Flüchtlingsheime eröffnet worden seien. Hunderte Flüchtlinge seien also in die Gegend gezogen, und doch sehe sie kein Anzeichen dafür in den Straßen. „Es ist, als hätte sich gar nichts geändert“, sagte sie ein wenig enttäuscht. Sie schilderte ihre vereitelten Versuche, in die Heime zu gelangen: Strenge Sicherheitsvorkehrungen und lange Registrierungszeiten erschwerten den Kontakt zu den Flüchtlingen. „Die müssen die Regeln ändern“, sagte sie. Magdalene Heuser widersprach: „Wir können nicht herumsitzen und warten, dass irgendjemand etwas ändert. Nur indem wir selbst tätig werden, erzwingen wir Veränderung.“ Sie hat recht. Der Staat wird immer versagen – juristisch, sozial, politisch –, weil Nationen auf der Basis von Ausgrenzung errichtet werden. Ideale Bedingungen für offene Gesellschaften gibt es nicht und wird es vermutlich niemals geben. Wir können nur auf mehr Inklusion hinarbeiten und hoffen, dass unsere Bemühungen national und international möglichst bald geeignete Maßnahmen nach sich ziehen.
11. Was fehlt noch in deinem Leben?, fragte Adania die Neuankömmlinge. Jetzt, wo ihre Grundbedürfnisse gestillt sind, was wünschen sie sich? Die überwältigend eindeutige Antwort war: Privatsphäre. Ein Zimmer für sich allein. Salem, Magdalene Heusers syrischer Freund, fügte hinzu, dass er gern einen eigenen Internetanschluss hätte. Was daran gemahnte, dass der virtuelle Raum lebensnotwendig ist, weil viele Neuankömmlinge mit der Welt, die sie zurückgelassen haben, nur dort wieder in Kontakt kommen können.
12. Elvira Hanemann, die Buchhändlerin, erzählte von einem neuen Projekt, das sie im Rahmen der größeren Initiative vor Ort, Friedenau hilft!, ins Leben gerufen habe, das Kulturcafé. Alle vierzehn Tage sollen Kulturabende stattfinden, an denen Neuankömmlinge und Alteingesessene sich treffen und einander durch Musik, Film, Kunst, Tanz und Literatur besser kennenlernen können. „Falls Sie Vorschläge haben, melden Sie sich bei mir“, bat Elvira, „wir brauchen mehr Freiwillige und mehr Ideen!“
13. „Wir müssen Neuankömmlinge als politische Akteure wahrnehmen, Menschen mit der Fähigkeit, unserer Demokratie Ideen, Worte und Energie hinzuzufügen“, überlegte Katja Ponert. „Wir müssen diese Angst vor dem Fremden überwinden und diese Angst, irgendetwas zu verlieren.“
14. „Vielen Dank“, sagte Zahraa im Anschluss zu mir, „vielen Dank für diese Gelegenheit, vor Publikum zu sprechen. Ich wollte den Leuten unbedingt mitteilen, was ich denke.“ Ein paar Tage später schrieb mir ihre Lehrerin Silke: „Vielen Dank, dass Sie Zahraa die Chance gegeben haben, zu glänzen. Mein Student Saddam, den Sie kurz kennengelernt haben, war von dem Abend sehr beeindruckt. Er hat einen kurzen Einblick in ein Deutschland bekommen, mit dem er in seinem Heim überhaupt keinen Kontakt hat.“ Wir alle, besonders aber die Neuankömmlinge, kommen wieder und wieder an. Ständig treten wir irgendwo zum ersten Mal ein – in verschiedene Lebensphasen, neue Beziehungen, ungeahnte Herausforderungen, andere Perspektiven, unbekannte Haltungen. Jede Ankunft stellt nicht nur einen Anfang dar, sondern eine Beteuerung des Daseins, eine Siegesfahne der Beständigkeit.
15. Der vielleicht aufschlussreichste Teil des Abends kam nach der Veranstaltung, als die Leute sich miteinander unterhielten und ich hörte, wie eine Frau zu einer anderen sagte: „Ich wüsste gern, wer die anderen Flüchtlinge waren, die beiden, die den Abend organisiert und moderiert haben.“ Sie meinte Adania und mich. Ich war erstaunt, dass selbst diese aufgeschlossenen Menschen, die den Kontakt mit Neuankömmlingen suchen, automatisch annehmen, alle nicht-weißen Menschen im Raum seien nicht von hier. In diesem Fall hatte die Frau natürlich recht. Adania und ich stammen beide aus anderen Ländern, aber wir sind auch von hier. Genau wie die Neuankömmlinge. Eines Tages, bald. Sobald wir uns vorstellen können, dass sie es bereits sind.
Dieser Text von Priya Basil erschien zuerst im Zeit-Blog 10 nach 8.
Meet your neighbours in der Buchhandlung ISARFLIMMERN
Wenn man sich begegnet, ist alles möglich. Ein Bericht vom Auftakt der WIR MACHEN DAS-Veranstaltungsreihe in München mit Björn Bicker und Rania Mleihi.

Die Verbindung Rania Mleihi und Björn Bicker war ein Glücksfall. Das Publikum saß zwei Künstlern gegenüber, die nicht nur eine Sprache für ihre Arbeit fanden, sondern auch eine für ihre Gefühle und Unsicherheiten. Hinzu kam, dass Rania Mleihi ausgesprochen gut deutsch spricht. Es also keiner vermittelnden Stimme bedurfte. Das Publikum außerdem erleben konnte, wie entspannt man öffentlich sprechen kann, und wie es gelingen kann, sehr persönliche Erfahrungen so zu schildern, ohne sich dabei zu entblößen.
Björn Bicker stellte die richtigen Fragen nach Herkunft, Ausbildung, Leben als Frau in Damaskus, den Gründen Damaskus zu verlassen. Der Zwischenstation Ungarn. Und nach der Ankunft in München. Wie ist es hier zu sein.
Rania zog bereits vor fünf Jahren aus persönlichen Gründen nach Budapest. Sie lebte dort vier Jahre, ohne als Künstlerin arbeiten zu können: „Ungarn ist wie Syrien, Viktor Orban, der Geheimdienst, die Rolle der Frau…“ Seither war sie nicht mehr in Syrien gewesen, aber sie möchte dort auch nicht mehr hin.
Warum? Das ist nicht ihr Land. Sie hat sich schon immer noch Deutschland gesehnt. Sie lernt seit 2008 deutsch, war bereits zwei Mal da gewesen, bevor sie jetzt nach Deutschland/München kam, das eine Mal davon war sie zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. Sie kann in Syrien nicht „Rania“ sein, sagt sie, als Künstlerin habe sich ihre Arbeit dort erschöpft. – Das sagte sie so sicher und selbstverständlich, aber man konnte dennoch spüren, dass diese klare Einsicht mit Trauer verbunden ist. Auch später gab es noch einmal so einen Moment, das war, als sie mit Björn dialogisch ihren Text „Wasser“ vortrug, in dem sie davon erzählt, wie es ihr geht, wenn sie von ihrer Heimat hört, und wie sie auf Facebook syrische Posts liest. Einige davon hat sie übersetzt, die las Björn, der mit ihr auch den darin enthaltenen Dialog übers „Weggehen“ oder „Bleiben und kämpfen“ las, was auch immer das heißt: ist weggehen und für die Freiheit kämpfen nicht auch kämpfen?

Verblüffend noch vor der Lesung dieses Textes die Antwort auf Björns Frage: Was mit ihr geschieht, wenn ihr Menschen erzählen, wie es in Syrien jetzt ausschaut und was dort geschieht. Sie glaube das dann nicht, sagt Rania. Worauf Björn sagt: Du glaubst das nicht? Worauf sie antwortet: Es ist, wie wenn du mir sagst: Das Wasser (im Glas vor ihr) ist schwarz. Es wird dabei so klar, dass in ihrer Wahrnehmung ein Unterschied besteht, zwischen durch mündliche Erzählung Erfahrenem und durch gelesene Worte Erfahrenem. Das fiel mir im Nachhinein auf.
Die Einspielung des Radiobeitrags, den Rania für den Bayerischen Rundfunk gemacht hat („Messages from Refugees“) war großartig, genauso wie das Selbstinterview, nachzuhören unter
Die Geschichte von Rania ist, wie so viele Geschichten von geflüchteten Menschen, eine ganz eigenständige und singuläre und das hat sich sehr vermittelt, am 14. April beim Auftakt von „Wir machen das, jetzt“ in München. Jeder Mensch, der hier ankommt, kommt aus ganz spezifischen Gründen, die gewiss einen gemeinsamen politischen Hintergrund haben, aber sich auf jeden Menschen und seine Entscheidung anders auswirken. Mit so einer Erzählung, wie der von Rania am vergangenen Donnerstag Abend beginnt die Masse eben in Einzelschicksalen aufzugehen.
Wir kennen jetzt eine Frau, die aus ganz persönlichen Gründen den Weg von Damaskus über Budapest nach Deutschland auf sich genommen hat, eine Künstlerin ist, die etwas zu sagen hat, an den Münchner Kammerspielen etc. arbeitet, und dennoch bis Juli nur eine sogenannte „Fiktions-Bescheinigung“ bekommen hat. Das heißt: Sie darf erst einmal dableiben: bis Juli. Sie hat Angst, was dann passiert, darüber muss sie die ganze Zeit nachdenken.
Ich tue das jetzt auch.
Womöglich tun das jetzt alle fünfzig Gäste aus der Buchhandlung Isarflimmern und alle dortigen Mitarbeiterinnen.
Denen wir um Übrigen sehr zu danken haben, für den wunderbaren Ort, das Engagement für die Veranstaltungsreihe und die finanzielle Unterstützung.
Begegnungsort Buchhandlung in Mainz-Gonsenheim
Jugendliche Newcomer aus Syrien und Afghanistan erzählen in der Nimmerland Kinderbuchhandlung von ihren Erfahrungen.

Proppenvoll war die einzige Kinderbuchhandlung von Rheinland-Pfalz im Mainzer Stadtteil Gonsenheim, die durchaus auch das Gespräch mit Erwachsenen sucht, in diesem Fall mit Flüchtlingen oder wie man korrekter sagt: mit Geflüchteten. Die Inhaberin Susanne Lux hatte für den 15. März eingeladen, die Buchhandlung als neutralen Ort zu nutzen, weniger um freiwillige Helfer zu finden, als eine Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen von Alt- und Neu-Gonsenheimern zu bieten.
Vier jugendliche Betroffene hatten sich bereit erklärt Fragen zu beantworten, ein bisschen zu erzählen. Zwei junge Männer und zwei noch jüngere Frauen, 16-jährige Schülerinnen, die seit 3 Monaten in Mainz sind und ein Gymnasium besuchen, bereits einen erstaunlichen deutschen Wortschatz besitzen und akzentfrei sprechen. Eine aus Syrien, eine aus Afghanistan, ein Jahr unterwegs gewesen, konnten sie viele Länder aufzählen, die sie auch ganze Strecken zu Fuß durchwandert hatten. Einige Angehörige waren an diesem Abend da, viele afghanische und syrische Sprachschüler, ansonsten viele, viele interessierte Mainzer, die sich anschließend austauschten über Erfahrungen und Fragen stellten nach Adressen zum Helfen. Viele Kontakte konnten geknüpft werden, Handynummern wurden ausgetauscht, Praktikumsplätze besprochen. Auch die verschiedenen Vereine und Anlaufstellen für Geflüchtete, die bisher noch nicht miteinander vernetzt waren, kamen ins Gespräch. Alles in allem ein äußerst runder, zutiefst befriedigender Abend, der mehr im Stadtteil angestoßen hat, als wir zu hoffen wagten.
Meet your neighbours in der Buchhandlung LEHMKUHL
Linda Benedikt und Martin Umbach im Gespräch mit dem syrischen Mathematiker Mohammad Nasir Mohammad über seine Flucht und sein Leben in München.

Es war eine ungewöhnliche und beeindruckende Veranstaltung, die am 24. Mai in unserer Buchhandlung stattfand. Die Münchener Schriftstellerin Linda Benedikt vom lokalen WIR MACHEN DAS-Bündnis hatte den syrischen Mathematiker Mohammad Nasir Mohammad zu einem Gespräch über seine Flucht und sein Leben in Deutschland eingeladen.
Mohammad floh aus der syrischen Stadt Deir-ez-Zur zunächst in die Türkei, wo er für den amerikanischen Rundfunk arbeitete, die Sendungen nach Syrien ausstrahlten. Als er über Facebook Morddrohungen vom IS erhielt, suchte er den Weg nach Deutschland und kam letztlich nach München. Seine Frau konnte ihm folgen und auch einer seiner Brüder ist mittlerweile hier. Ihre Eltern leben unter Drohungen und Entbehrungen im einem vom IS besetzten Landesteil, Kontakt haben sie nur selten und die im syrischen Krieg verbliebenen Familienangehörigen können ihre Stadt nicht verlassen.
Die 50 Zuhörer der Veranstaltung waren beeindruckt von Mohammads Bericht und noch mehr von seiner kraftvollen positiven Lebenseinstellung und seiner offenen Haltung allem gegenüber, was ihm in Deutschland begegnet. Mit auf dem Podium war auch der Schauspieler Martin Umbach, bei dem Mohammad für fünf Monate wohnte. Beide schilderten im Wechsel, wie bereichernd sie diese Zeit erlebten und was sie alles voneinander lernten. Beeindruckend war für uns Zuhörer vor allem eines: die persönliche BEGEGNUNG und das GESPRÄCH. Es macht einen Riesenunterschied, ob man tagtäglich nur die Nachrichten über die Flüchtlingskrise liest und hört oder ob man jemanden kennen lernt, dessen Erfahrungen auf der Flucht einem den Atem rauben. Danach sehen alle Zahlen und Statistiken zum Thema anders aus. Eine Buchhandlung ist ein guter Ort, um solchen Begegnungen und Gesprächen einen Raum zu geben.

Deutsch-arabischer Erzählsalon in der Buchhandlung am Paulusplatz in Bonn
Die Buchhandlung war bis weit über den letzten Platz hinaus gefüllt – mit Stammkunden, aber auch mit Syrern, so dass ins Arabische übersetzt werden musste.

Genau wie am 10. März in der Buchhandlung Neusser Straße in Köln, wo wir erstmals zu “Begegnungsort Buchhandlung” eingeladen hatten, übernahmen auch an diesem Dienstagabend in Bonn Larissa Bender und Abdul-Rahman Alawi die Übersetzung aus und ins Arabische, damit alle Gäste dem Gespräch folgen konnten. Es ging wieder gut los mit dem Bericht von Heike Thelen, der Buchhändlerin aus Köln, die im August 2015 einen 14jährigen afghanischen Jungen bei sich aufgenommen hat. Sie erklärte, welche bürokratischen Hürde zu überwinden sind, gab aber auch ein sehr positives Bild vom Zusammenleben mit einem Jungen, der anfangs kein Wort einer Sprache konnte, die sie verstanden hätte. Man verständigte sich mit Zeichensprache, ab und an kam ein Übersetzer. Es gibt viele unbegleitete Jugendliche, denen die Aufnahme in eine Familie weiterhelfen würde, die Jugendämter sind dafür zuständig.
Abdul-Rahman Alawi erklärte anschließend, weshalb er ausschließlich Literatur von arabischen Frauen verlegt. Es geht ihm um die Innensicht der arabischen Gesellschaften, die er in diesen Romanen am besten vermittelt sieht. Wer sich dafür interessiert, wie die Menschen, die hierherkommen ticken, findet die Antwort in den Büchern des Alawi-Verlags. Zu Syrien besonders in denen von Rosa Yassin Hassan, die heute in Hamburg lebt und sicher bald in der Buchhandlung am Paulusplatz lesen wird.
Larissa Bender sprach über ihre Übersetzungen und die Bücher zu Syrien, die sie herausgegeben hat. Auch sie sieht den wesentlichen Zugang zum Verständnis der Ereignisse in der Literatur. Der von ihr herausgegebene Sammelband »Innenansichten aus Syrien« versammelt Texte syrischer Autoren und Aurorinnen, die sich mit der Lage im Land, den inneren Befindlichkeiten, den Traumata und der Gewalt beschäftigen. Unter den AutorInnen ist auch Rosa Yassin Hassan.
Dinan Hesso las die erste Erzählung aus dem Buch ihres Vaters Niroz Malek: »Le promeneur d’Alep« (»Der Spaziergänger von Aleppo«). Ich hatte zuvor die Übersetzung seines Textes aus dem Französischen gelesen. Es geht darin um die Frage, weshalb der Autor Aleppo trotz des Krieges nicht verlassen kann, weil er nämlich seine Seele zurücklassen müsste. Ein ergreifender Text, den Dinan Hesso nicht ohne Stocken vortragen konnte. Sie sprach im Anschluss über ihren Vater, mit dem sie nur Kontakt hat, wenn das Internet in Aleppo gerade mal funktioniert. Das Buch wird von Larissa Bender aus dem Arabischen übersetzt werden und Anfang 2017 bei uns im Weidle Verlag erscheinen. Dies ist übrigens ein Ergebnis des letzten Begegnungs-Abends bei Dorothee Junck in Köln. Nach der Veranstaltung wurde in der Buchhandlung am Paulusplatz bei einem Glas Sekt der Übersetzervertrag unterschrieben.
Den Schlusspunkt bildete Nyazi Bakki, Ehemann von Dinan Hesso, ein syrischer Dokumentarfilmer, der schon seit einigen Jahren an einem Film über den vom IS verschleppten Jesuitenpater Paolo Dall’Oglio arbeitet. Er hatte noch einige Stunden mit dem Pater drehen können, bevor er verschleppt wurde, es sind sicher die letzten Aufnahmen dieses mutigen Mannes, über den auch Navid Kermani in seiner Friedenspreisrede 2015 ausführlich gesprochen hat. Es wäre wichtig Sponsoren zu finden, damit der Film fertiggestellt werden kann.
Der erste Begegnungsort Buchhandlung in Hamburg
Auf Einladung von Stephanie Krawehl von der Buchhandlung Lesesaal und Christiane Hoffmeister vom Büchereck Niendorf Nord trafen die Hamburger Autorinnen Kristine Bilkau und Isabel Bogdan und vier Geflüchtete zum Gespräch in der Veranstaltungsreihe „Begegnungsort Buchhandlung“. Ein Erwachsener und ein Jugendlicher aus Syrien sowie zwei Jugendliche aus Afghanistan erzählten im Büchereck Niendorf aus ihrem Leben.

Einer spricht sehr gut Englisch. Einer spricht sehr gut Deutsch. Zwei sprechen nicht gut Deutsch und gar kein Englisch. Ihre Muttersprache ist Pashtu, wir haben einen Dolmetscher für Arabisch, aber keinen für Pashtu. Also muss es auf Deutsch gehen. Es macht nichts, dass sie nicht so gut sprechen, denn das ist ja auch Teil des Themas. Es macht doch etwas, denn manchmal verstehen wir sie nicht. Wir verstehen aber, dass einer als Vierzehnjähriger von den Taliban rekrutiert werden sollte und deswegen geflohen ist. Wir verstehen nicht, was mit seinem Vater und seinem Bruder geschehen ist. Wir verstehen aber, dass sein Vater und sein Bruder tot sind, und wir verstehen, dass seine Mutter weiß, dass er in Deutschland lebt, seine anderen Geschwister ihn aber für ebenfalls tot halten, denn so ist es sicherer für sie. Wir sind unsicher, wie weit wir fragen sollen, was wir dürfen, wo die Grenze ist. Wir sind unsicher, ob wir seinen Namen öffentlich sagen sollen, oder ob auch das gefährlich ist. Er möchte gern Polizist werden, was aber nach deutscher Gesetzeslage zumindest sehr schwierig ist. Vielleicht Feuerwehrmann. Aber erstmal möchte er besser Deutsch lernen.
Ein anderer möchte Medizin studieren oder Krankenpfleger werden, er macht gerade ein Praktikum bei einem Zahnarzt. Aber erstmal möchte er besser Deutsch lernen. Auch seine Geschichte war schwer zu verstehen, das Wort Daesh kam darin vor. Die beiden sind eher schüchtern, außerdem sprachlich unsicher, aber sie sitzen hier vor einem Publikum und erzählen von sich, schnell und leise.
Der dritte Jugendliche lebt in einer deutschen Familie. Er ist erst seit neun Monaten hier, in der Schule geht es ihm zu langsam, er spricht fast fließend Deutsch. Er würde gern das deutsche Abitur machen, aber das darf er nicht, denn er hat das syrische Abitur, und das wird hier anerkannt. Zweimal Abitur machen geht nicht. Vielleicht besucht er trotzdem die deutsche Oberstufe, um schneller weiterzulernen. Danach will er Zahnmedizin oder Medizintechnik studieren. Er glaubt, dass er Asyl bekommen wird, denn er ist nicht nur Syrer, sondern auch noch Kurde, und das ist noch schlimmer, sagt er und lacht vorsichtig. Er trägt ein Gedicht vor, das er seiner Freundin zum Geburtstag geschrieben hat, es geht um die Liebe. Mit der Freundin ist er jetzt nicht mehr zusammen, sie ist immer noch in Syrien.
***
What makes people leave their home?
What makes people leave their family?
What makes people leave their house, their county, their friends?
What makes people leave their job?
What makes people leave everything they have?
What makes people take a boat in the middle of the night?
It is hope. Hope for a better life (or for life at all), hope for a future, hope for peace and safety. Hope is what makes people leave their home. Hope is everything they have. Hope is what keeps them going. They have nothing else left but hope.
Der Vierte, ein erwachsener Mann aus Syrien, erzählt, er habe sich diese Fragen gestellt, warum Menschen alles aufgeben, was sie sind und haben, warum sie ihr Leben aufs Spiel setzen und bei Nacht in ein kleines Boot steigen, bis er selbst bei Nacht in ein kleines Boot gestiegen ist. Als in dem Boot Panik aufkam, hat er sich auf seinen Beruf besonnen, sein Beruf ist Kommunikation, und hat die Leute beruhigt. Es gibt eine Chance von fünfzig Prozent, sagt er, man kommt mit dem Boot auf der anderen Seite an, oder man kommt nicht an.
Und wenn man dann endlich in Deutschland ist, dann wird nicht plötzlich alles gut. Dann muss man warten. Auf eine Unterkunft, ein Interview in der Behörde, einen Antrag, einen Arzt, ein Bett, das nächste Interview, auf Bearbeitung des Antrags, auf eine Arbeitserlaubnis, auf Deutschunterricht, auf Klärung des Aufenthaltsstatus, man muss warten, warten, warten, und das ist nicht so einfach, wenn man arbeiten und ein neues Leben anfangen und für sich selbst sorgen möchte. Warten. Das ist das, was er in Deutschland gelernt habe, sagt er, warten. Dass man in Deutschland immer warten muss. (In anderen Ländern kann man diese Dinge mit Bakshish erledigen, kommt an anderer Stelle heraus.) Ansonsten möchte er nicht so viel über sich sprechen, sondern lieber allgemein bleiben.
Der Betreuer der Jugendlichen, ein Mann aus dem Irak, der seit über zwanzig Jahren in Deutschland ist, spielt zum Abschluss auf der Oud und erzählt uns, die Oud sei gewissermaßen die Mutter aller Saiteninstrumente. Er spielt ein arabisches Lied, und ein paar einzelne Leute singen mit, dann spielt er Hava Nagila, und alle singen mit, und dann spielt er Muss i denn, und alle lachen, und dann gibt es ein wundervolles Essen, das ein libanesischer Restaurantbesitzer spendiert hat. Man steht noch herum und unterhält sich, ein Freund der drei Jungs ist auch da und hat seine helle Freude am Lieferfahrrad der Buchhandlung, er darf natürlich damit fahren. Eine alte Dame verabredet sich mit einem der Jugendlichen für den nächsten Tag, um ihm ein bisschen Hamburg zu zeigen, weil sie herausgefunden hat, dass seine Schule ganz in der Nähe ihrer Wohnung liegt. Und wir merken, dass wir wissen wollen, wie es für die Vier weitergeht, ob sie ankommen, ob sich ihre Hoffnungen erfüllen, und beschließen, dass wir uns alle wieder verabreden müssen.
Meet your neighbours bei BUCH IN DER AU
Am 23. Juni, dem gefühlt bisher heißesten Abend des Jahres, stellte die Autorin Katja Huber die dreiköpfige syrische Band جِسْر jisr (Brücke) vor – umso schöner, dass Buch in der Au bis auf den letzten Platz besetzt war, genau wie wahrscheinlich jeder einzelne Münchner Biergarten. Und das Publikum war sich einig – es hat sich gelohnt.

Bei eisgekühlten Getränken begrüßte Buchhändlerin Elisabeth Reisbeck alle alten und neuen Münchner, die sich hier bei Buch in der Au zusammenfinden durften.
Der dritte Münchner Abend von WIR MACHEN DAS-Begegnungsort Buchhandlung stand ganz im Zeichen von arabischer Musik: Für Percussion & Gesang sorgte Mohcine Ramadan, Ehab Abou Fakhar spielte Bratsche und Abathar Kmash die Oud. Dabei reichte die Bandbreite der Stücke von Kompositionen aus dem 11. Jahrhundert über die Wagner-Zeit bis in die Neuzeit, von Syrien über Ägypten, die Türkei, Tunesien, Algerien, Marokko und Andalusien, was für eine eindrucksvolle und abwechslungsreiche Mischung sorgte. Die meisten Stücke haben keinen eigenen Titel, sondern sind nach Komponist und Skala, in der sie gespielt werden, benannt. Eigenkompositionen des Trios gibt es noch nicht. Immerhin besteht es erst seit vier Monaten, denn Ehab und Abathar sind erst im Januar nach Deutschland gekommen. Gerade deshalb ist es erstaunlich, wieviele Konzerte die Band bereits im Raum München gegeben hat.
Als Glücksfall erwies sich, dass Mohcine Ramadan, der an der LMU im Fach Deutsch als Fremdsprache promoviert und bereits seit mehreren Jahren in München lebt, wunderbar als Übersetzer fungieren konnte. Die anderen beiden Bandmitglieder sind professionelle Musiker aus Damaskus, in ihrer Geburtsstadt Suweida leitete Abathar eine Musikschule mit 70 Schülern. Nach der Flucht ist es ihm natürlich nicht möglich, seine Arbeit an der Schule wie gewohnt fortzusetzen, aber immerhin kann Abathar von München aus noch ein kleines Mädchenorchester von elf Schülerinnen leiten. Er schickt ihnen Noten, sie nehmen das Stück auf und er gibt ihnen etwa via Skype Feedback. Gemeinsam bereiten sie sich gerade auf ein Konzert Ende Juli vor.
Mitglied im syrischen Symphonieorchester, Dozententätigkeit an der Musikhochschule Damaskus, Teilnahme an internationalen Workshops – Ehabs und Abathars Lebensläufe sind beeindruckend, was sie bescheidener Weise darauf zurückführen, dass es in Suweida in jedem Haus eine Oud gibt und in jeder Familie etliche Musiker.
Auf die Frage, wie es so schnell gelingen konnte in München als Musiker Fuß zu fassen und so viele Konzerte zu spielen, antwortet Mohcine zunächst im Scherz, dass man wohl über die Balkanroute gekommen sein muss, um Interesse zu wecken, dann aber deutlich ernster, dass Musik einfach verbindet, weil keine Sprache nötig ist, um in Kontakt zu kommen, z.B. mit dem namhaften Oud-Spieler Roman Bunka, mit dem sie bereits des Öfteren in verschiedenen Formationen aufgetreten sind. Klar wurde im Gespräch mit Katja Huber aber auch, dass Mohcine als Dozent und als Musiker im kulturellen Leben Münchens gut vernetzt ist und so für die noch sehr junge Band „Die Brücke“ auf Kontakte zurückgreifen kann, die er über mehrere Jahre geknüpft hat.
Ihre Musik wird von Rhythmen getragen, die darüber entscheiden, ob getanzt – was häufig vorkommt – oder ob zugehört wird, wobei es bei den metaphernreichen Texten zumeist um Heimat und Liebe geht.
Das berufliche Leben in München dagegen gestaltet sich nicht ganz so mühelos. Auch als professionelle Musiker mit abgeschlossenem Studium müssen Abathar und Ehab hier in gewisser Weise von vorne anfangen, und sich an der Musikhochschule bewerben und vorspielen, weil hier die Schwerpunkte anders gelegt werden. Abathar z.B. stellt sich jetzt auf Jazzgitarre ein, weil es Oud als Studienfach schlichtweg nicht gibt.

Am Ende des runden Abends kam bei dem sehr interessierten Publikum die Frage auf, ob es schon eine CD der Band gäbe, was leider nicht der Fall ist, naheliegenderweise aus finanziellen Gründen. Ein klassischer Fall für Crowdfunding – ein Vorschlag aus dem Publikum, den Mohcine Ramadan so gut fand, dass er ihn gleich als mögliches to-do an die Initiative WIR MACHEN DAS weitergab. Abschließend wurde auf die nächsten Konzerte der Band verwiesen, etwa am 8.7. im Café Giesing, am 15.7. im YA WALI in Haidhausen und am 23.7. im Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße.
Wer hat mein Eis gegessen? Die erste dreisprachige Kinderlesung auf dem Sommerfest am Arnswalder Platz
40 Kinder hatten am 9. Juli vor dem Pavillon auf der Spielplatzwiese beim STIERISCH GUT-Sommerfest in Berlin Platz gefunden. Einige waren vorher am Stand der Sparkasse, wo es immer besonders viel zu gewinnen gibt, hängengeblieben und wurden von May, der Interpretin des arabischen Textes, herübergerufen.

May hatte für die Lesung der Geschichte „Wer hat mein Eis gegessen?“ von Rania Zaghir extra Sandspiel-Eiswaffeln ihres Sohnes mitgebracht. Damit liefen Stephan – der Verleger der Edition Orient, in der „Wer hat mein Eis gegessen?“ erschienen ist –, May und Golshan, die den persischen Text sprach, gestisch zur Hochform auf. Das kleine Mädchen in der Geschichte will nichts anderes, als voller Genuss ihr Eis essen. Aber ständig kommt ihm jemand in die Quere, der besser weiß, wie das geht: Der Greif, die Nixe – alle wollen ihm zeigen, wie man ein Eis leckt, ohne sich zu bekleckern! Als am Ende fast nichts mehr für das Mädchen selbst übrig ist, trifft es eine Entscheidung…
Stephan, May und Golshan forderten die Kinder auf, jedes Mal, wenn sie das Wort „Eis“ auf Deutsch, Arabisch oder Persisch hören, die Hand zu heben. Das war gar nicht so einfach. Alle lauschten daraufhin sehr konzentriert und verpassten keine Pointe.
Nach der Lesung malten die Kinder – die nicht wie ausgeschrieben 3 bis 7 Jahre, sondern eher zwischen 3 und 13 Jahren alt waren – auf Biertischen bunte Eiskugeln mit Sahnehauben und Schirmchen. Für die schönsten Bilder waren Gutscheine für die Eismanufaktur Rosa Canina gegenüber der Spielplatzwiese versprochen.

Unter den Betreuerinnen machte sich Unruhe breit, wenn nur einige gewinnen, würde es bestimmt Streit geben. Letztendlich bekamen alle, die ein Bild gemalt hatten, einen Eisgutschein, obwohl Judith von der Buchhandlung Die Insel mit Pokerface auf die Einwürfe der Kinder „Es gewinnen ja alle!!“ steif und fest behauptete, nein nein, da seien schon die besten Bilder ausgewählt worden…
Diese Irritation war in der Schlange vor dem Eissalon aber sofort vergessen. Alle Einwände gingen in himmlisch cremigem Vanille- Schoko- oder Mangoeis unter – und keiner, wirklich keiner, kam dabei in die Quere.
Meet your neighbours in der Buchhandlung KUNST- UND TEXTWERK
Die Dramatikerin Amahl Khouri gab in der Buchhandlung Kunst- und Textwerk im Westend einen Einblick in ihr Dokumentar-Stück “She He Me” und führte im Anschluss ein anregendes Gespräch mit Lena Gorelik und dem Publikum über Transgender in arabischen Ländern, Vorurteile, Wissenslücken und Grenzen der Toleranz.

Amahl Khouri sitzt auf dem Boden, hat ihre Fingerspitzen aneinandergelegt und lauscht hoch konzentriert. Sie verfolgt die Uraufführung der deutschen Fassung ihres Theaterstücks „She He Me“. Um sie herum etwa 25 Zuhörer auf den Holzstühlen der Buchhandlung Kunst- und Textwerk im Westend. Sie sehen Szenen aus einem Theaterstück, das auf Englisch schon in Abu Dhabi, New York und Augsburg gezeigt wurde und im Dezember Premiere in den Münchner Kammerspielen haben wird – in der Atmosphäre eines Wohnzimmers.
Vor dem Sofa die kleine Bühne: Hier werfen sich Amahl Khouris syrische Freundin Yara Seifan, die Münchner Autorinnen Sandra Hoffmann und Linda Benedikt Fragen und Drohungen um die Ohren. Sie lesen die Geschichte der Transgender-Aktivistin Randa aus Algerien, die Amahl Khouri über Jahre begleitet und interviewt hat. Das Stück erzählt aus dem Leben dreier Akteure aus der LGBT-Bewegung des mittleren und nahen Ostens, wobei jeweils eine Figur im Vordergrund steht und die anderen beiden Darsteller sie in unterschiedlichen Rollen dabei unterstützen, ihre Geschichte zu erzählen. Die Szenen beginnen mit der aufdringlichen Neugier, die einer Transgender-Frau in der westlichen Welt entgegenschlägt und nehmen uns mit zurück in eine Zeit, als aus dem algerischen Mann mit Frau und Kind eine Transgenderaktivistin wurde, die schließlich von der eigenen Familie aus Angst vor Repressalien, aus Scham und Hass aus dem Land vertrieben wird.
„Wir haben die Geschichten, aber keine Theaterstücke“, war Amahl Khouris Schlüsselerkenntnis, die sie dazu brachte, Dokumentartheater zu machen und die Erlebnisse anderer LGBT-Akteure aus ihrem Netzwerk auf die Bühne zu bringen. Sie ist erst seit vier Monaten in München, ist bereits in der Theaterszene vernetzt und steckt mitten in der Inszenierung ihres Stücks für die Kammerspiele. Nach der Lesung nimmt sie auf dem Sofa Platz und beantwortet im Gespräch mit Lena Gorelik und dem Publikum jede einzelne Frage mit großer Präsenz. Sie wirkt authentisch, engagiert und nimmt alle Anwesenden mit ihrer Persönlichkeit ein. Dank ihrer deutschen Mutter hat sie einen deutschen Pass und ist so der aufenthaltsrechtlichen Definition nach kein Flüchtling. „Ich habe aber Zuflucht gesucht“, so Amahl Khouri. Sie hat den Libanon verlassen, weil sie Ihre Stücke nicht der Zensur aussetzen wollte und ihr nicht nur alle Möglichkeiten, sich künstlerisch weiterzuentwickeln, verwehrt wurden, sondern es schier unmöglich war, ihre Themen auf die Bühne zu bringen. In Deutschland will sie die Sprache ihrer Mutter und alles über die für sie unglaublich vielfältige Theaterarbeit lernen und selbst noch möglichst viel beitragen.
„Das war ein Ausflug in eine andere Welt“, ist das Fazit einer Besucherin. Dass diese Welt für uns fremd ist, nicht nur weil sie im mittleren Osten stattfindet, wurde auch Lena Gorelik bei der Übersetzung des Stückes deutlich. Für viele Wörter des ursprünglich englischsprachigen Stücks fehlen im Deutschen wie im Arabischen schlichtweg die Äquivalente. Hier wie da müssen sich Homosexuelle und Transgender noch verorten. Und vielleicht ist auch das Thema der Grund, dass im Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen nur etwa die Hälfte an Zuhörern den Weg in die Buchhandlung fand.
Die, die da sind, bleiben nach dem offiziellen Teil. Sie sprechen mit Amahl Khouri und ihrer syrischen Freundin und untereinander: über eigene Vorurteile, Wissenslücken und Grenzen ihrer Toleranz. Und so geht das Prinzip, Nachbarn zu treffen und mit der Veranstaltung über den Abend hinaus zu wirken, auf. Was bleibt ist, Amahl Khouri viel Erfolg für ihren künstlerischen Weg zu wünschen und gespannt auf die Kammerspielinszenierung im Dezember zu warten.
Meet your neighbours in der Buchhandlung Pfeiffer
Am 6. September fand der fünfte Abend der Münchner Reihe „WIR MACHEN DAS – Begegnungsort Buchhandlung“ statt. Der syrische Dichter und Journalist Yamen Hussein stellte einige seiner Texte vor und sprach mit dem Münchner Autor Fridolin Schley über das Leben in Syrien und Deutschland und das Schreiben in Zeiten des Krieges.

Yamen Hussein ist jung. Das dunkle Haar hat er zu einem Zopf zurückgebunden, sein Blick ist wach und zugewandt. Er gibt ausführlich und ernsthaft Auskunft, dazwischen blitzt immer wieder feine Ironie auf – man kann sich sofort vorstellen, dass seine journalistischen Texte so engagiert wie pointiert sind. In seiner Heimatstadt Homs wurde Yamen bereits 2006 mit Anfang 20 wegen erster kritischer Artikel zwangsexmatrikuliert (vom Mathematikstudium!) und einige Tage inhaftiert. Diese abschreckend gemeinten Maßnahmen seien in seinem Fall jedoch „kontraproduktiv“ gewesen, wie er erzählt: Fortan schrieb er, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
2011, im Jahr der Revolution, arbeitete er kurz für einen regierungsnahen Radiosender, kündigte aber bald, weil ihm die Propaganda zuwider war. Das machte ihn bei Assads Alawiten unbeliebt, er (selber Alawit) musste Homs verlassen und floh nach Damaskus. Dort arbeitete er in einer geheimen Gruppe von Oppositionellen. Sie demonstrierten, bauten Schulen in den zerstörten Gebieten wieder auf und Yamen verfasste regimekritische Texte. Die Gruppe gab ihm ein Gefühl der Stärke, es war „ein Raum der Freiheit“. Doch 2013 tauchte sein Name auf schwarzen Listen der Milizen auf, einige Freunde wurden verhaftet. Die Gefahr kam, den komplexen Verhältnissen in Syrien entsprechend, gleich von mehreren Seiten: vom syrischen Geheimdienst, aber auch von einer islamistischen Gruppe. Yamen versteckte sich wochenlang in den Bergen und unternahm erste Fluchtversuche über den Libanon und die Türkei.
Aus seinem Gedicht „Exil“:
2. Am Flughafen – Atatürk ist verärgert zum dritten Mal
Ich werde dich lieben – morgen – wenn ich
den Sicherheitscheck bestanden habe und die Passkontrolle samt dem Blick
in die kleine Kamera.
Dann passiere ich den Detektor – aufrecht wie ein König,
schwerelos wie eine Möwe, die furchtlos sogar einem Jäger
den Bissen zwischen den Zähnen entreißt.
Ich strecke die Arme von mir wie eine Vogelscheuche, wie
Jesus am Kreuz, damit sie meinen Körper abtasten
und scannen. Die Beine gespreizt wie ein Hund beim Pinkeln.
Sollen sie doch die Munition finden, die ich im Hodensack
verstecke, und die Handgranate zwischen meinen Nieren.
Die Schuhe ziehe ich lieber nicht aus, sonst kommt mir der
Weg womöglich so leicht vor, dass ich einfach loslaufe und
allen Reisenden um den Hals falle.
Die Bodenfliesen waren kalt und strahlten wie dein Gesicht
an einem Wintermorgen. Atatürk aber schaute finster drein
und schickte mich zurück.
Im Dezember 2014 kam er schließlich legal über das Writers in Exile-Programm des PEN nach München. Von der neuen Heimat berichtet er positiv. Zum Vertrautwerden mit der Stadt machte er lange Spaziergänge mit seiner Kamera, auf die er oft keinen Stadtplan oder elektronische Hilfsmittel mitnahm – so musste er sich, um den Rückweg zu finden, bei Passanten durchfragen.
Im Gespräch klingt immer wieder durch, wie schwierig und zwiespältig der Aufenthalt häufig ist, trotz seiner zur Zeit durch das Stipendium gesicherten Situation. Die Konzentration im täglichen Deutschkurs wird durch die Sorgen um die Familie in Homs und die aktuellen Nachrichten immer wieder beeinträchtig. Zur Kommunikation nutzt er hauptsächlich Skype, da der Familie vom Sicherheitsdienst drohend mitgeteilt wurde, dass Social Media und Telefon abgehört werden. Mit Galgenhumor stellt Yamen die Frage, wie es der Sicherheitsdienst denn wohl überhaupt rein zeitlich schaffen solle, sämtliche Flüchtlinge abzuhören … und weist auf die „fehlende Sicherheitsrelevanz der Kontakte“ hin, er nennt lächelnd Beispiele: „Meine Mutter gibt mir Rezepte durch, wie ich bestimmte syrische Gerichte richtig zubereiten soll. Mein Vater ermuntert mich, schnell Deutsch zu lernen.“ Es ist der Versuch, so etwas wie eine gemeinsame Alltagsebene aufrechtzuerhalten. Die Dinge, die uns allen wichtig sind, und die auch im Exil wichtig bleiben.
Ein weiterer Auszug aus „Exil“:
5. Skype mit meiner Mutter
Gestern fiel ihr ein, dass sie mich einmal wegen einer
schlechten Mathematiknote geschlagen hatte. Sie hatte damit
erreichen wollen, dass ich mich künftig mehr anstrenge.
Sie weinte auf Skype und bat Gott, ihr zur Strafe die Hand
zu brechen, die sich gegen mich erhoben hat.
Es hat mir das Herz zerrissen.
Ich schwor bei ihren grauen Haaren und ihren Tränen, dass
ich mich nicht erinnerte und ihr nicht böse bin.
Wie soll ich ihr klarmachen,
dass ich von ihr keine Narben trage
außer dem Nabel?
Besonders seltsam war für Yamen ein Moment am Tag des Amoklaufs im Juli 2016, als er am Marienplatz plötzlich einen Anruf von seiner Mutter erhielt, die sich in Homs um seine Sicherheit sorgte. Bangen einmal andersherum, und jeder, der diesen Tag in München erlebt hat, wird sich noch leichter vorstellen können, was es heißt, Tag für Tag aus der Ferne die Ungewissheit über das Schicksal naher Menschen ertragen zu müssen.
Das Schreiben, so Yamens Antwort auf Fridolins Frage nach dessen Bedeutung in Zeiten des Krieges, hilft beim Verarbeiten und dient auch der Dokumentation. Direkt die Politik beeinflussen könne man damit wohl nicht, aber an den Reaktionen des Regimes merke man doch, dass die Stellungnahmen stören. Und er betont, wie sehr er in Europa die Freiheit zur Meinungsäußerung schätzt, Charlie Hebdo inklusive. Seine Texte kreisen jedoch nicht nur um den Krieg und die Wunden, die er in Land und Leuten hinterlässt. Er liest aus einem Brief an eine syrische Freundin, melancholisch, aber auch witzig: sie amüsieren sich über ihre „hochnäsige Kritik zweier geflüchteter Schriftsteller“, die das Talent der Deutschen eher bei Philosophie, klassischer Musik und Autobau sehen als in der modernen bildenden Kunst.
Mit Blick auf die aktuellen Mediendebatten bedauert Yamen, dass die Flüchtlinge zu oft alle in einen Topf geworfen werden. Eine differenzierte Wahrnehmung würde die Newcomer bei der Aufarbeitung ihrer eigenen Erlebnisse und beim Neubeginn unterstützen. Zu den jüngsten Wahlerfolgen der AfD sagt er, er kenne aus seiner Heimat zur Genüge, wie Angst zur Stimmungsmache genutzt wird. Und dass daraus nichts Gutes entsteht.
Für Syrien ist Yamen überzeugt, dass es einen Umsturz braucht, vermutlich mit Hilfe von außen, und dann einen Neubeginn. „Jeder Tag unter Assad ist ein Tag mit mehr Gefallenen“, fasst er die nach wie vor katastrophale Lage zusammen.
Wenn sein Asylantrag bewilligt wird, möchte Yamen nach Ablauf seines Stipendiums in München bleiben. Sein Traum ist, auch hier wieder journalistisch arbeiten zu können, Deutschlernen steht also weiter an erster Stelle. Zum Schluss des Gesprächs wechselt er spontan ins Deutsche (schon vorher hatte sich bei den Fragen angedeutet, wie viel er bereits versteht) – und zitiert Sophie Scholl mit ihren letzten Worten „Die Sonne scheint noch“. Die „Weiße Rose“, hier in München ein persönlicher Anknüpfungspunkt für ihn bezüglich der Erfahrungen mit Unterdrückungssystemen in unterschiedlichen Zeiten. Der Geschwister-Scholl-Platz ist für Yamen Hussein zu einem seiner „Hoffnungsplätze“ in München geworden, neben dem Englischen Garten und dem Café, wo er den ersten Kaffee nach seiner Ankunft trank – Orte, an denen er neue Kraft findet, wenn die Verzweiflung zu groß zu werden droht.
Einige seiner Gedichte erscheinen nächstes Jahr in einer Anthologie des PEN. Und bereits für die kommende Buchmesse ist die Anthologie „Weg sein – hier sein. Texte aus Deutschland“ im Secession Verlag angekündigt, in der Texte von 19 Autorinnen und Autoren, darunter 17 aus Syrien, einschließlich Yamen Hussein, versammelt sind.
Ich freue mich auf weitere Texte von ihm, in Übersetzung und demnächst vielleicht auch auf Deutsch. Und bin dankbar für einen weiteren Abend der Begegnung, der einen Mensch mit seiner Geschichte und seinen Talenten sichtbar gemacht und uns Zuhörern neue Eindrücke aus erster Hand geschenkt hat.
Die Buchhandlung Pfeiffer in der Hohenzollernstraße war bis auf den letzten Platz besetzt, beziehungsweise sogar noch darüber hinaus, von den rund fünfzig sehr interessierten Zuschauern mussten einige auf dem Boden sitzen. Franziska Sperr vom deutschen PEN-Zentrum hatte den Kontakt zu Yamen Hussein hergestellt, sie war ebenso im Publikum wie Peter Tarras, der einen Großteil der vorgetragenen Gedichte aus dem Arabischen übersetzt hat. Als Dolmetscherin half Marwa Amara aus Tunesien, die an der LMU Jura und Politikwissenschaften studiert. Und den Gastgeberinnen Dorothee Luther, Dominika Hirschler und Michaela Kube ist für Wasser, Wein, eine Frischluft-Pause und die freundliche Atmosphäre insgesamt zu danken.
Begegnungsort Buchhandlung bei Proust Wörter+Töne in Essen
Am 6. September fand der fünfte Abend der Münchner Reihe „WIR MACHEN DAS – Begegnungsort Buchhandlung“ statt. Der syrische Dichter und Journalist Yamen Hussein stellte einige seiner Texte vor und sprach mit dem Münchner Autor Fridolin Schley über das Leben in Syrien und Deutschland und das Schreiben in Zeiten des Krieges.

Dass der Erzählsalon am 19. September bei Proust Wörter+Töne auch ein vergnüglicher Abend werden sollte, war dem großartigen Moderator Frank Goosen besonders wichtig. Zu Beginn las er deshalb seine eigens für diesen Abend entstandene Geschichte über Sprachbarrieren und Integrations-Übungen im Internet: „Weine nicht, meine Freund.“
Anschließend berichtete das Ehepaar Bita und Khalil Kermani vom Avicenna Kultur- und Hilfswerk von ihrem aktuellen Einsatz auf Lesbos und in Thessaloniki: Seit Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze ist Griechenland für die meisten Menschen auf der Flucht zur Endstation geworden. Auch auf Lesbos geht es auf legalem Weg nicht weiter. 93.000 Menschen sind hier seit Anfang des Jahres gestrandet; im August nur etwa 1000, zum September hin kommen im Schnitt täglich 50, an manchen Tagen aber auch fast wieder 300 aus der Türkei nach. Mit eindrucksvollen Fotos dokumentierte das Ehepaar die dramatische Lage der hier gestrandeten Flüchtlinge. „Die Kermanis arbeiten unter ganz unglaublichen Bedingungen, gehen hier in Deutschland jeweils vier bis sechs Wochen ihrer Arbeit nach, um dann wieder notleidende Flüchtlinge in den Lagern ärztlich zu versorgen”, betonte Frank Goosen, beeindruckt von ihrem Engagement.
Nach einer Pause mit Getränken, Snacks und angeregten Gesprächen berichtete Danny Friedrich von dem Projekt mund:ART und dem von ihm in diesem Rahmen inszenierten Theaterstück „Wir sind wie Sterne“, das Ende August in Essen Premiere hatte. Esra, eine junge Syrerin, und Anas und Musrafa, zwei junge Syrer, erzählten im anschließenden Gespräch von ihren Erfahrungen in Deutschland Fuß zu fassen, ihren Berufswünschen, von zig unbeantworteten Bewerbungsschreiben und ihrem Bedürfnis, insbesondere mehr junge Deutsche kennenzulernen.

Das Publikum war durchgehend begeistert von dem informativen Abend, den Akteuren und den angeregten Gesprächen mit ihnen. Schön zu sehen war auch, dass trotz des ernsten Themas viel gelacht wurde. Wir konnten zudem die 265,- € Eintrittsgelder – aufgestockt auf 300,- € – als Spende für Avicenna weitergeben und haben zusätzlich noch 160,- € Spenden für hiesige Aufgaben gesammelt.
Klar ist, dass wir weitere Abende zum Themenkomplex organisieren werden: WIR MACHEN DAS!
Ich komm auf Deutschland zu
Am 17. Oktober fand im Rahmen von Literatur:BERLIN die ausverkaufte Premiere von Firas Alshaters Buch »Ich komm auf Deutschland zu« statt. Fast 200 Besucher feierten im Palais der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg den syrischen Filmemacher und YouTube-Star.

Der Kunstgriff an Firas Alshaters Texten und YouTube-Videos ist sein unvergleichlicher und intelligenter Humor. Genau damit trifft er die Leute ins Herz. Er weiß, wovon er spricht, da er in seinem Land zu spüren bekam wie es ist, wenn die Gedanken nicht frei sind. Bis vor zweieinhalb Jahren wurde er in seiner syrischen Heimat für seine politischen Videos sowohl vom Assad-Regime als auch von Islamisten verhaftet und gefoltert. Erst die Arbeit an einem Film brachte ihm das ersehnte Visum für Deutschland, und seitdem lebt und arbeitet er in Berlin.
„Niemand wird als Flüchtling geboren“, sagt der 25-Jährige. „Die Umstände zwingen einen dazu.“
Firas Alshater trägt mit seinen gezielten Vergleichen mehr zur Völkerverständigung zwischen Einheimischen und Geflüchteten bei als so manche Politiker.
Meet your neighbours in der Sendlinger Buchhandlung
Am 26. Oktober traf Denijen Pauljević in der Sendlinger Buchhandlung in München auf Shadi Mallouk und Soro Giovani Baba. Gemeinsam sprachen sie über Sport und Motivation, die Bedeutung von Erfolg sowie über ihr früheres Leben, das Ankommen und die Kommunikation in der neuen Umgebung. Es war ein Abend, der viel darüber erzählte, wie sehr Sport – so Shadi Malouk – Kultur ist.

Der ehemalige syrische Basketballnationalspieler Shadi Malouk ist vor drei Jahren nach München gekommen und trainiert inzwischen die Jugend- und Damenmannschaft des BC Hellenen. Soro Giovani Baba ist neunzehn Jahre alt, kommt von der Elfenbeinküste, von wo er als Dreizehnjähriger während des Krieges unbegleitet aufbrach. 2014 kam er in Deutschland an, machte 2016 den Hauptschulabschluss und hat vor einigen Monaten eine Ausbildung als Straßenbauer begonnen. Er wollte eigentlich Profi-Fußballer werden, wegen einer schweren Knieverletzung ist das jedoch nicht möglich.
„Sport ist language“, sagt Shadi bereits in dem kleinen Dokumentarfilm von Suli Kurban, den der Autor, Dramaturg und Musiker Denijen Pauljević zu Anfang der Veranstaltung zeigt. Shadi ist darin als Basketballtrainer zu erleben. Er wiederholt diesen Satz an diesem Abend mindestens noch einmal, und es ist zu spüren, wie ernst es ihm mit dieser Aussage ist, und wie er das lebt, wenn er sagt, er sei im Sport zuhause, es sei einfach mit Menschen zu kommunizieren im Sport, weil es eine gemeinsame Sprache gebe. Es mache es leicht, dass man ein gemeinsames Ziel habe. Und später, als er sagt, dass er nicht das Gefühl habe, der Ball sei aus Plastik, sondern sein Gefühl zu diesem Ball sei Liebe. Der Antrieb Deutsch zu sprechen, rühre aus seiner derzeitigen Profession als Basketballtrainer, er spüre, er spreche noch viel zu schlecht Deutsch, um darin unterrichten zu können, weil er für den Sport zu langsam spreche, im Sport gehe alles so schnell, seine Ansagen müssen also auch schnell sein. Deshalb spricht er derzeit beim Training noch eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Eine Mischung, die er im Übrigen auch an diesem Abend sprach, und die sehr schön klingt.
Giovani Baba ist ebenfalls im Sport sozialisiert, bereits als kleiner Junge geht er auf eine Sportschule, also eine Schule, die gleichzeitig normale Schule ist, in der aber täglich Fußball trainiert wird. Sein Vater schickte ihn dorthin. Auf der Flucht spielt er in Libyen in der Junioren-Nationalmannschaft, aber nach einer Auseinandersetzung, über die er nicht genauer erzählt, will er dort nicht mehr bleiben. Als er schließlich in Deutschland ankommt, hat er ein irreparabel verletztes Knie. Das ist deshalb schlimm, weil er, so sagt er das noch immer: sehr glücklich sei, wenn er mit dem Ball auf dem Fußballfeld stehe.
Jetzt macht er eine Ausbildung als Straßenbauer, was ihm gut gefällt, weil er immer draußen ist.
Beide, sowohl Shadi als auch Giovani dachten, es würde furchtbar werden hier in Deutschland. Beide erleben jetzt das Gegenteil: Es ist gut hier, sagen sie. Und wenn man sich darüber wundert, muss man erleben, wie beide auf äußerst eindringliche Art und Weise für ein Leben in Gewaltlosigkeit genauso wie ein Leben ohne Drogen stehen. Zitat Shadi: „Wenn jemand ein Problem hat mit mir, dann bin ich freundlich – ich habe gelernt so zu kommunizieren, dass es gut ist.“ Zitat Giovani: „Wenn man versucht mit mir zu kämpfen, dann gehe ich einfach weg. Ich habe so viele Dinge gesehen in meiner Heimat, ich will es gut haben.“
Insgesamt war dies ein beachtenswert unaufgeregter und von großer Ruhe geprägter Abend, durch den Denijen so geführt hat, dass man am Ende das Gefühl hatte, hier drei ganz wunderbare, genauso in Demut wie in Selbstbewusstsein geschulte Männer, frei von jeglichem Machismo, kennengelernt zu haben.
Schönstes Zitat von Giovani, gefragt wie er sich fühle, wenn er, da er eben nicht hellhäutig ist, angeschaut wird: „Wenn mich Leute anschauen, dann denke ich, die schauen mich an, weil ich so gut angezogen bin oder so gut aussehe.“
Von Shadi auf Denjiens Frage, was er sich wünsche, was aus ihm werde: „Ich habe vor vier Jahren alles verloren. Jetzt starte ich neu. Was aus mir wird, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, gute Chancen zu haben. Ich lebe jetzt. Und ich würde mich schämen, wenn ich sagen würde, ich brauche etwas, weil: Somebody needs more.“
Wie verändert Mutterschaft das Leben von Frauen im Exil?
Zur Finissage der Ausstellung „Ich habe mich nicht verabschiedet | FRAUEN IM EXIL“ von Heike Steinweg sprach die Schriftstellerin Dilek Güngör am 15. Januar mit Dima Al-Bitar Kalaji , Doha El Jaduh und Nivin Maksour über ihre Erfahrungen als junge Mütter im Exil, über Kindererziehung und das Leben zwischen den Sprachen.

Was erzählt man einem Kind vom Krieg? Wie spricht man über das, was man auf der Flucht erlebt hat? Die Kinder von Dima Al-Bitar Kalaji und Nivin Maksour sind noch zu klein, um Fragen zu stellen. Dimas Tochter ist acht Monate alt, Nivin hat eine zweijährige Tochter und ein kleines Mädchen, das erst vor zwei Monaten, in Berlin, zur Welt gekommen ist. Allein der siebenjährige Sohn von Doha El Jaduh wäre alt genug, um seine Mutter zu fragen. „Aber er stellt keine Fragen“, sagt Doha. Ihr Sohn war zwei, als die Familie aus Syrien floh. Sie weiß nicht, woran er sich erinnert. Die Familie floh mit dem Jungen und seiner acht Monate alten Tochter erst in den Libanon, dann in die Türkei, von dort nach Griechenland, weiter nach Ungarn, wo die Familie von der Polizei aufgespürt und ins Gefängnis gebracht wurde. Sie floh nach Österreich und musste, weil man in Ungarn ihre Fingerabdrücke hatte, wieder zurück nach Debrecen, in ein Heim, wo Dohas jüngstes Kind geboren wurde. Im Februar 2015 erreichte die Familie Berlin. Doha sagt, sie sei manchmal froh, dass ihr Sohn keine Fragen stelle. Sie und ihr Mann wollen nicht über diese furchtbare Zeit sprechen müssen. „Es reicht, dass wir es erlebt haben, wir wollen es nicht noch einmal erleben, indem wir es unserem Sohn erzählen.“
Doha, Nivin und Dima sind drei der Frauen, die die Fotografin Heike Steinweg für ihre Ausstellung „Ich habe mich nicht verabschiedet |Frauen im Exil“ porträtiert hat. So sitzen wir umringt von den großformatigen Fotografien in der Galerie des Tempelhof Museums und machen uns am letzten Tag der Ausstellung Gedanken, wie das Muttersein das Leben der Frauen verändert hat und noch immer verändert. Lama Al Haddad, die 2013 ebenfalls aus Syrien geflohen ist, dolmetschte unser Gespräch. Auch sie ist auf einem der Bilder zu sehen.
Wie darüber sprechen? Das ist eigentlich keine Frage, die man in einer solchen Runde ausführlich erörtern kann, ich habe sie dennoch gestellt, weil die Journalistin Dima in dem Text zu ihrem Foto beklagt, dass ihre Eltern ihr stets ein geschöntes Bild von Syrien gemalt haben. „Das möchte ich für meine Tochter nicht. Ich werde ihr sagen, dass der Krieg nicht von einem Tag auf den nächsten über uns hereingebrochen ist. Das hat sich lange angebahnt.“ Auch Nivin sagt, sie möchte sich später den Fragen ihrer Kinder stellen. „Ich werde ihnen sagen, was mit ihrem Onkel geschehen ist, wenn sie es wissen wollen.“ Nivin geht davon aus, dass ihr Bruder in Syrien im Gefängnis getötet wurde. „Als wir im Gefängnis nach ihm gesucht haben, hat man uns weggeschickt und gesagt, wir sollten ihn vergessen.“ Was tatsächlich mit ihm geschehen ist, weiß sie nicht. Sie hat ihn seither nicht mehr gesehen.
Wir kommen vom wie auf die Frage, in welcher Sprache die Mütter mit ihren Kindern sprechen. Dima spricht auf Arabisch zu ihrem Baby, doch Nivin hat sich für Englisch entschieden. In Syrien hat sie englische Literatur studiert, nach ihrer Flucht aus Hama lebte sie drei Jahre in der Türkei und arbeitete dort für die französische NGO Handicap International. Ihr Mann spricht Arabisch mit den Töchtern. „Und in der Kita lernt unsere große Tochter Deutsch.“ Das Sprachenlernen scheint Nivin leicht zu fallen, sie spricht schon gut Deutsch und bereut, dass sie während ihrer Zeit in Hatay in nicht auch noch Türkisch gelernt hat. Doha spricht mit ihren Kindern Deutsch. „Ich habe mich nicht bewusst dazu entschieden, das kam einfach so“, sagt sie. Dass das einfach so kommen konnte, liegt daran, dass Deutsch Dohas zweite Muttersprache ist. Sie kam aus dem Libanon als Vierjährige nach Deutschland. 16 Jahre lebte sie in Nordrhein-Westfalen, 16 Jahre lang war der Aufenthaltsstatus der Familie unsicher, über Jahre wurde ihre Duldung verlängert, schließlich wurde Doha 2006 mit ihren Eltern und Geschwistern in den Libanon abgeschoben. „Ich wusste nicht, dass meine Eltern sich ständig melden mussten, zum Schluss sogar jede Woche.“ Doha hat inzwischen einen Ausbildungsplatz zur Sozialassistentin, aber wie lange sie in Berlin bleiben kann, ist unklar. Sie ist derzeit mit ihrer Familie von der Abschiebung nach Ungarn bedroht.

„Besonders in der Zeit nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich alleine gefühlt und meine Mutter sehr vermisst“, sagt Dima. Dima wie auch Nivin haben versucht, ihre Mütter nach Deutschland zu holen. „Aber es hat nicht geklappt“, sagt Nivin. „Mein Mann hat mir geholfen, so gut er konnte, aber durch seine Kopfverletzung ist er in seinen Bewegungen eingeschränkt.“ Zudem muss er oft mehrere Stunden am Tag in physiotherapeutische Behandlung. Als ich Doha frage, ob es auch sein Gutes habe, die Verwandtschaft nicht immer um sich zu haben, lacht sie. „Natürlich. Mir wurde als Kind vieles verboten. Ich durfte zum Beispiel nie mit auf Klassenfahrten. Meine Kinder sollen überall mitgehen dürfen. Wenn meine Eltern hier bei uns wären, würden sie mir bestimmt in alles hineinreden.“ Auch das Publikum lacht und Dima sagt, sie leide zwar unter der Entfernung, aber genieße auch die größere Freiheit, die ihre kleine Familie nun habe. „Die große Nähe innerhalb syrischer Familien ist einerseits schön, aber sie lässt dem Einzelnen wenig Freiraum für eigene Entscheidungen.“
„Gibt es etwas, was ihr mit nach Syrien nehmen wolltet, wenn ihr denn zurückgeht“?, fragt jemand aus dem Publikum. Doha will nicht zurück, nicht nach Syrien und nicht in den Libanon, aber Nivin und Dima möchten wieder in Syrien leben. „Das Land braucht uns“, sagt Dima. „Wir können viel lernen von Deutschland, das auch einen Krieg erlebt hat und anschließend ein mächtiges Land geworden ist.“ Nivin nickt.
Meet your neighbours bei Buch & Café Lentner in München
Am 26. Januar fand der achte Abend der Münchner Reihe „WIR MACHEN DAS – Begegnungsort Buchhandlung“ statt. Der syrische Schriftsteller Fouad Yazji und die Münchner Übersetzerin und Autorin Silke Kleemann sprachen über den Atheismus im frühen Islam, über die Inspirationsquellen von Yazijs Romanen, die Revolution, die Liebe und das Arbeiten und Leben im Exil.

Man kann wohl von Pech sprechen, wenn man erst direkt zu Veranstaltungsbeginn erfährt, dass die Arabisch-Übersetzerin unglücklicherweise verhindert ist. Aber nicht nur die Tatsache, dass sich Silke Kleemann und Fouad Yazji davon nicht beeindrucken ließen, machte den Abend besonders. Denn auch die achte Münchner WIR MACHEN DAS-Veranstaltung bei Buch & Café Lentner in Haidhausen war bis auf den letzten Platz belegt. Schon am Tag zuvor war ein Artikel über den syrischen Autor in der Süddeutschen Zeitung erschienen, der zurecht neugierig machte.
Fouad Yazji ist vor einem Jahr nach München gekommen, und auf die Frage, was für ihn das Besondere an München sei, gerät er ins Schwärmen – wie ein Wunder sei es, wenn man aus der Gefahr in ein Land von Frieden und Liebe kommt, „ein Paradies“, meint der Syrer, mit einer Altstadt, die auf ihn wirkt wie ein großes Freilichtmuseum. Auch das Schreiben gehe hier, in Frieden und Freiheit, fast besser von der Hand, unter einem Volk von Vieldenkern. Eine Enttäuschung gab es aber dennoch. Yazji hat einen Roman namens Die blaue Wolga über Nietzsche geschrieben, dessen Werk er seit Jahren verehrt und der riesigen Einfluss auf ihn hatte. Als er nach Deutschland kam, war er der Meinung, Nietzsche sei der Prophet der Deutschen, hier würden ihn sicherlich alle ebenso lieben wie er. Dass er jedoch nur auf Schulwissen stieß, verwunderte ihn sehr. Denn Nietzsche war es auch, der ihm als erster gezeigt hatte, dass es keinen Gott gibt – womit wir bei einem der Themen des Abends angekommen waren.
In diesem Frühjahr wird in der PEN-Anthologie „Zuflucht in Deutschland“ ein Text von Fouad Yazji mit dem Titel „Die Geschichte des Atheismus im frühen Islam“ erscheinen. Diesen Text las zunächst Yazji in Abschnitten auf Arabisch, dann Silke Kleemann auf Deutsch vor, und wir erfuhren, weshalb dieses Thema von so großer Brisanz ist: Fouad hat wegen dieser Art von Texten Schwierigkeiten in Syrien bekommen, denn heutzutage dürfen Zweifel an der Existenz Gottes nicht mehr offen ausgesprochen werden. In der Blütezeit der arabischen Aufklärung dagegen, also zwischen 800-1000 n.Chr., war das ganz anders. Erstmals wurde der Gedanke geäußert, dass der Verstand nicht dasselbe ist wie das Wort der Propheten – heutzutage ein vollkommen tabuisierter Gedanke, und ein Zustand, nach dem sich Fouad sehnt. Die Hoffnung, dass irgendwann wieder eine so freie Stimmung in Syrien herrschen wird, hat er nicht aufgegeben, auch wenn es gerade sehr düster darum steht.

Mit seinem Text will Fouad, der mit 20 Atheist geworden ist, darauf hinweisen, dass der Atheismus nicht, wie weithin angenommen, im Westen entstanden ist, sondern auch im arabischen Sprachraum alte Wurzeln hat. Heutzutage, so Fouad Yazji, herrsche in Europa die Meinung, dass Muslime viel im Koran lesen. Er aber betont, dass das nicht stimme, da es etliche muslimische Länder gibt, in denen gar nicht Arabisch gesprochen wird. Wer den Koran selbst liest und gebildet ist, zweifle automatisch an den ganzen Geistergeschichten. Denn weder der Koran, noch eine der anderen großen religiösen Schriften führt seiner Meinung nach den Beweis an, dass es Gott gibt.
Als anderen wichtigen Einfluss für sein Schreiben nennt er den persischen Dichter Rumi (1207-1273). Die Liebe ist Fouad Yazjis wichtigstes Thema, und Rumis Schriften haben ihn an seine erste Liebe erinnert. Dazu erklärt er, dass in Syrien eine ganz andere Vorstellung von Liebe herrscht, vielmehr spirituell als sexuell. Dort genügt ein Blick der Geliebten – nur ein einziger erwiderter Blick – für wochenlanges Glück. In Europa dagegen – so sein erster Eindruck, auch gestützt durch Kino und Literatur – werden die Frauen tagsüber wie Heilige verehrt, und nachts nimmt man sie mit ins Bett. So konnte er, als er mit 20 Jahren in Russland studierte, die Frauen dort nicht lieben, sie entsprachen nicht seinen Vorstellungen von Schönheit und waren so selbständig, dass es ihm nicht möglich war, sie zu verehren.
Auch das Buch, an dem er gerade schreibt, dreht sich darum – um Revolution und Liebe in den Zeiten des islamistischen Terrors. Was und wie er darüber erzählt, lässt den Zuhörern den Atem stocken. Mit 16 Jahren war er in ein Mädchen verliebt, zu dem er irgendwann den Kontakt verlor. Viele Jahre später muss er sich bei seiner Schwester im schwer umkämpften Homs verstecken; es gibt keine Lebensmittel mehr, und wenn doch, kein Geld, welche zu kaufen; man kann nicht mehr heizen und auch der Strom springt nur sporadisch an. Zufällig entdeckt er dieses Mädchen, als der Strom den Fernseher kurz in Betrieb setzt, in einer Nachrichtensendung. Sie ist mittlerweile Oppositionspolitikerin geworden und es gelingt ihm Kontakt zu ihr aufzunehmen. Schließlich wird sie es sein, die ihm bei der Flucht hilft. All das verarbeitet er in seinem neuen Roman. Bisher ist leider noch keiner seiner vier Romane auf Deutsch erschienen – vielleicht wird dieser ja der erste, der komplett übersetzt wird.
Dass er jemals nach Syrien zurückkehren wird, bezweifelt Yazji allerdings. Sein Land sei ruiniert, alles was ihn persönlich damit verbunden habe, sei zerstört. Umso mehr wünscht er sich Frieden, Demokratie und Menschenrechte – also genau die Werte, die den ursprünglichen Gedanken der Revolution ausgemacht haben.
Besonders schön waren die vielen Wortmeldungen, als Silke Kleemann die Runde für Fragen öffnete. Ein Agnostiker und großer Fan von Fouad fragte nach einem Weg für Schriftsteller, um zu der Bewegung Richtung Demokratie beizutragen. Fouad ist der Meinung, dass die Hoffnung niemals sterben dürfe, auch wenn die Lage gerade sehr hoffnungslos sei. Der Weg zu einer ausgewogenen Zivilisation sei immer ein Prozess, bei dem jeder nur mitwirken kann, indem er seine Pflicht erfüllt. Und leider zeige ein Blick auf die Geschichte, dass ein solcher Prozess durchaus einige hundert Jahre in Anspruch nehmen könne.
Auch nach der offiziellen Veranstaltung wurde im Einzelgespräch noch weiter über die aktuelle Lage in Syrien, über Literatur und Lösungsmöglichkeiten diskutiert, auf Arabisch, Englisch und Deutsch.

WIR MACHEN DAS-Erzählsalon bei Einar & Bert auf dem internationalen literaturfestival berlin
Anlässlich des 16. internationalen literaturfestivals berlin (ilb) organisierte WIR MACHEN DAS einen Erzählsalon, um das Programm um die Perspektive und die Blickwinkel von Newcomern zu erweitern. Durch den Abend im September 2016 in der Theaterbuchhandlung Einar & Bert führte die Schriftstellerin Svenja Leiber.

Gemeinsam mit den Gästen gelang es, spannende und interessante Diskussionen anzustoßen. So nahm der syrische Archäologe Bashar Shahin – bei gemeinsamen geschichtlichen Anknüpfungspunkten wie den Ursprüngen des Namens „Europa“ oder dem Ursprung unseres Alphabets bis zur heutigen Zeit beginnend – sein Publikum mit auf eine magische Reise zu den uralten syrischen Städten mit ihrer Jahrhunderte alten Geschichte.
Daran schloss sich ein Gespräch zwischen Svenja Leiber und mir selbst – Lina Alhaddad, Psychologin aus Syrien – an. Wir sprachen über Flucht und darüber, wie sich solche Erfahrungen und Erlebnisse auf die Persönlichkeit der Betroffenen auswirken. Aber auch Heimat und das Ankommen in der Fremde wurden thematisiert. Denn Hidschāb, Frauenbilder, Stereotype und Vorurteile in den Medien, verändern die Selbstwahrnehmung und nehmen Einfluss auf die Persönlichkeit.
Zeichnen sie sich durch besonders westliche Kleidung aus? Hören sie elektronische Musik? Sprechen sie Englisch oder Deutsch? Tragen sie keinen Hidschāb? Hält der Hidschāb Frauen davon ab, sich für eine neue Gesellschaft zu öffnen?
Ich persönlich finde die Diskussion um den Hidschāb nicht zielführend, denn die dichotome Kategorisierung von Frauen in „Hidschāb-Trägerin“ und „Frau ohne Hidschāb“ impliziert auch eine Zweiteilung in richtig und falsch. Dabei ist die Entscheidung den Hidschāb abzulegen, immer durch unsere individuellen Erfahrungen und Erlebnisse geprägt. Zu generalisieren und anzunehmen, lediglich die eigene Position sei dabei die richtige, ist überheblich und egozentrisch.
Als Newcomer musst du dich immer vorstellen, etwas über dich erzählen, tief in dich gehen und wissen, was dich ausmacht. Das Ganze natürlich möglichst ehrlich und authentisch. Die meisten entscheiden sich dafür mit ihrer Nationalität zu beginnen, – ich wurde in Syrien geboren. Oder sie erzählen aus welcher Stadt sie kommen, – Ich komme aus Damaskus. Vielleicht wird noch das Geschlecht erwähnt, – ich bin eine Frau. Und dann kommt die Religion, – ich wuchs in einer muslimischen Familie auf. Ich studierte und lebte viele Jahre im Ausland, das hat mich westlich geprägt.
Ich kam mit einem Studierendenvisum nach Deutschland, mit dem Flugzeug, also bin ich eigentlich eine Migrantin und keine Geflüchtete. Aber sind wir nicht alle Geflüchtete, egal ob wir diesen Status haben oder nicht? Sind wir nicht alle Kinder des Krieges?
Wenn es dir nicht gut geht, bist du froh, wenn du nicht danach gefragt wirst, wer du bist. Denn alles, was auf dich wartet, sind Zuschreibungen. Alle Erwartungen, die von außen an uns herangetragen werden, sind Teil dessen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Manchmal ändert sich die Reihenfolge dieser Zuschreibungen. Mit welcher soll ich also nun beginnen? Zur Zeit beginne ich meist mit „Psychologin“. Das ist das erste, was ich über mich erzähle. Und du?
Die Fragen variierten danach. Ein Syrer aus dem Publikum fragte die Deutschen nach ihren Erfahrungen mit Asyl. Andere diskutierten die Bedeutung des Erwerbs der deutschen Sprache für die Integration in die neue Gemeinschaft und das Recht der Newcomer, ihre Muttersprache zu bewahren.
Es ist nicht ein einziger Tropfen Wasser im Meer vor Mersin
Um die Poesie und die kulturelle Sprachvielfalt zu feiern, luden das Haus für Poesie und seine Partner – darunter auch das Aktionsbündnis WIR MACHEN DAS – unter der Schirmherrschaft der UNESCO am 21. März zum Welttag der Poesie in Berlin zu einem Konzert aus Versen, Sprachen und Stimmen ein. Über 200 Menschen waren der Einladung ins Max Liebermann Haus gefolgt, um den Gedichten von fünf verschiedenen Lyriker*innen aus fünf verschiedenen Ländern zu lauschen.

Kultur könne und müsse gesellschaftliche Dinge bewegen, hieß es in den Begrüßungsworten des Vorsitzenden der Stiftung Brandenburger Tor, Pascal Decker, dem es ein Anliegen war zu betonen, dass man mit einem lyrischen Abend wie diesem, mit Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern, auch auf politischer Ebene bewusst ein Zeichen setzen wollte. Beim Welttag der Poesie geht es um den Austausch und Zusammenhalt zwischen den Kulturen – und das nun schon zum 18. Mal, wie wir anschließend vom Leiter des Hauses für Poesie, Thomas Wohlfahrt, erfuhren. „Es sind gute Zeiten für Lyrik“, versicherte er und überreichte das Mikro an den Moderator der Veranstaltung, Knut Elstermann.
Was uns als nächstes erwarten sollte, sei eine Lesung aus Texten in der Originalsprache und der deutschen Übersetzung, die im Kopf vermischt, das besagte Klangkonzert erzeugen würden. Für mich klang diese Vorstellung erst einmal eher nach Sprachverwirrung: Englisch, Mazedonisch, Arabisch, Bulgarisch und zwischen alledem noch die deutsche Übersetzung? Doch er sollte Recht behalten. Als zwei Frauen die Bühne betraten und nacheinander auf Deutsch und Englisch die ersten Verse eines Gedichts von Alice Miller vortrugen, ergab sich in meinem Kopf ein harmonischer Singsang aus der einerseits sehr ruhigen Stimme Christiane Langes und den andererseits auffordernd schnelleren Worte der jungen neuseeländischen Dichterin, die in ihren Texten über zukünftige Tage, die wir nie geschehen lassen, immer neue Fragen aufwarf: How do you sing when your brain is gone? Wobei die Fragen teilweise erst in der deutschen Übersetzung zu konkreten Fragen wurden. If heaven has seasons – Gibt es im Himmel Jahreszeiten?
Ebenso intensiv, aber auch traurig wurde es anschließend, als Nikola Madzirov aus Mazedonien mit seiner Übersetzerin für die Lesung, Katharina Narbutovič, das Podest betrat und zum Mikro griff. In leisem Englisch erklärte er, er freue sich über die Möglichkeit, in Berlin, „am anderen Ende der Welt“, ein Gedicht über seine Heimat zu lesen. Er wolle zuvor jedoch an einen befreundeten Musiker erinnern, der ein paar Tage zuvor leider verstorben sei. Als er dann zu Lesen begann, veränderte sich allerdings nicht nur die Sprache, auch seine Haltung und Stimme gewannen mit einem Mal an Kraft, die sich, ohne dass ich auch nur ein Wort verstand, auf mich und den Rest des gebannten Publikums übertrug. Man kann auch etwas verstehen, wenn man nichts versteht. Madzirov, so zeigte sich schließlich in der deutschen Version des Gedichts, schreibt über seine Heimat und eine Generation, die unfreiwillig die Nachfahren von Geflüchteten wurde.

Das Wort Flüchtling spielte auch bei dem syrischen Dichter Aref Hamza eine große Rolle. Wie wir aus der Anmoderation von Knut Elstermann erfuhren, lebt Aref Hamza heute mit seiner Familie in Niedersachen, seine zwei Kinder sprechen bereits perfektes Deutsch. Hamza selbst ist dagegen jemand, der statt in die Zukunft vor allem in die Vergangenheit zurückblickt, seitdem er seine Heimat Aleppo verlassen hat. Thomas Wohlfahrt, der neben Aref Hamza auf der Bühne stand, um dessen Langgedicht auf Deutsch vorzutragen, erzählte uns, dass es noch keinen endgültigen Titel, allerdings zwei Vorschläge für das Gedicht gebe: „So habe ich die Hoffnung verloren“ oder „Wie wenn du dich umdrehst zu mir“. Wohlfahrt erklärte, er bevorzuge den zweiten Titel, da die Botschaft darin weniger aussichtslos sei. Man könne sich im Anschluss an die Veranstaltung also gerne bei dem Autor melden, um ihn wegen der Titelwahl zu beraten, scherzte Wohlfahrt weiter. Doch dann wurde es wieder ernst, als Aref Hamza selbst das Wort ergriff.
Im Mittelpunkt der Geschichte, die er zwischen den schnell vorgetragenen Versen erzählte, steht die Stadt Mersin an der türkischen Mittelmeerküste, einem Ankunftsort vieler syrischer Flüchtlinge. Hamza beschreibt darin, wie er am Strand nach verwandten Überlebenden oder Ertrunkenen suchte, aber auch, wie er in die Gesichter der einheimischen Leute sah, deren Augen nicht aus Trauer und Verlust, sondern lediglich des Regens wegen feucht waren. Hier hat keiner geweint. / Es ist nicht ein einziger Tropfen Wasser im Meer vor Mersin.
Doch auch wenn es in Mersin und hier in Deutschland für viele nicht so scheint – all das ist wirklich geschehen. Sein Fuß blutete schließlich noch immer, wegen der Wunde, die er sich auf der Flucht an einem Stacheldraht zugezogen hatte. Diese Ambivalenz zwischen der scheinbar heilen Welt, dem Verdrängen des Vergangenen und dem schmerzhaften Blick zurück zieht sich gemeinsam mit den Bildern von vorbeiziehenden Vögeln und dem Rauschen des Mittelmeers durch diesen lebhaften, tragischen Text. Ich wollte hingehen und das Meer zudecken mit einem Schal – das zitternde. / Die Luft ist erstickend sauber. / Ich wollte in einer Stadt am Meer leben, um dem Meer den Rücken zu kehren. Während er las, bewegte der Autor seine rechte Hand im Rhythmus seiner Worte, auf und ab wie das Meer und hielt sie dann schließlich wieder ganz still, fast mahnend. Ich werde als Flüchtling zurückkehren.

Mit diesen Bildern im Kopf ging der Abend weiter. Mirela Ivanova aus Bulgarien stellte sich auf Deutsch vor, wollte dann aber doch auf ihrer Muttersprache lesen, für die Bulgaren im Publikum. Sie freue sich besonders an diesem Tag, an diesem Ort und in dieser Stadt, in Berlin, zu sein. 1991 war sie zum ersten Mal in der deutschen Hauptstadt gewesen und davon beeindruckt, hatte dass sie ein Gedicht über ihren Aufenthalt geschrieben. Als sie dieses vortrug, verstand ich wieder nichts, bis auf die Straßen und Ortsnamen: Unter den Linden, Hauptbahnhof, Dahlem und Pankow, die sich ganz vertraut unter die bulgarischen Wörter mengten. Ja, es war ein Klangkonzert, aber da in fast allen Gedichten dieser verschiedenen Lyriker*innen die Orte besonders bildhaft beschrieben wurden, zeichnete sich in meinem Kopf zeitgleich das Bild einer Karte mit – mal war es eine Landkarte, dann wieder der Stadtplan von Berlin.

Zum krönenden Abschluss gab es dann noch etwas Deutsches von Bas Böttcher auf die Ohren, der bei seiner beachtlichen Körpergröße nur knapp aufrecht auf dem Podest und unter der Deckenbeleuchtung stehen konnte. Da er seine Texte aber ohnehin frei vortrug, ohne dafür am Pult lesen zu müssen, nutze er die Bühne, um sich, passend zu seiner Spoken Word Performance, gestikulierend links und rechts zum Publikum hinzubewegen.

Dabei gab es zwar keine neue Sprache zu erkunden, doch auch über die Dinge, die vertraut scheinen, ließ sich noch etwas Neues lernen. So wie über das Märchen der Bremer Stadtmusikanten, das parallel zur Situation Geflüchteter gelesen werden konnte: Bevor Hunde entscheiden auf Esel zu steigen und Katzen ihre Feinde die Hunde besteigen, bevor Vögel auf ihre Metzger die Katzen sich setzten und die vier ihre Rivalitäten vergessen und sich auf die Reise begeben allein, muss was Schlimmes geschehen sein. Doch dadurch, dass sie zueinander und aufeinander standen, waren sie gemeinsam so groß wie Giganten.
Abgerundet durch die dann folgenden abschließenden Worte Christine Merkels von der Deutschen UNESCO-Kommission ging der Abend mit einem Appell aus vier Stichworten und der Aufforderung, diese stets aufs Neue zu buchstabieren zu Ende: Frieden, Vielfalt, Freiheit und Innovation. Worte, die auch eine gute Zusammenfassung dieses Abends bilden, wie ich finde.
Meet your neighbours stellt das Projekt wolkenschlösser bei Literatur Moths in München vor
Aus Zahlen (Bürokratie) wird Erzählen (Kunst), so das Motto von wolkenschlösser. Seit 2014 vermittelt die Initiative jungen Geflüchteten die deutsche Sprache anhand von Erzählungen, Gedichten, Filmen, Sketchnotes und Comics. Beim Meet your neighbours-Abend am 12. April stellten sich die wolkenschlösser-Initiator*innen und -Teilnehmer*innen dem interessierten Publikum vor.

Sommer 2014: Bevor der Münchner Literaturwissenschaftler Sebastian Planck nach Abschluss seiner Doktorarbeit in das obligatorische tiefe Loch fallen kann, füllt er es mit einer großen Idee. Gemeinsam mit zwei Freunden beschließt er, wolkenschlösser zu gründen. Ein Projekt, das junge Geflüchtete zum Schreiben bringt. Alle drei haben bereits erste Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe gesammelt und sind überzeugt davon, dass eine neue Sprache nicht mit Bürokraten-Deutsch gelernt werden sollte. Also lehren sie kreatives Schreiben: bieten Workshops an, in denen sie mit Geflüchteten Geschichten schreiben, Comics zeichnen und Figuren erfinden. Das Vokabular erweitert sich dabei ganz von selbst, denn auch Superhelden haben Augen, Nase, Mund…
Der erste Workshop ist bunt zusammengewürfelt: Die Teilnehmer*innen sprechen unterschiedliche Sprachen, wenn Deutsch, dann auf unterschiedlichem Level, und sie sind zwischen 25 und 55 Jahre alt. Eine ihrer wenigen Gemeinsamkeiten: Keine*r ist mit Comics aufgewachsen.
Fast drei Jahre später: 12. April 2017, Literatur Moths. „Und doch“, erzählt Sebastian Planck, fast erstaunt, „hat dieser Workshop super funktioniert. Der Comic-Ansatz bietet einfach eine Art von Empowerment. Das relativ schnelle und einfache Schaffen von Sprache und Geschichte schafft Selbstbewusstsein.“ Eins wird im Gespräch mit Moderatorin Nora Zapf schnell klar: Sebastian Planck, der wolkenschlösser zu einem seiner vier Jobs zählt (dass nicht alle Brotjobs sind, versteht sich von selbst) und sich bei der Begrüßung des Publikums angesichts der ersten öffentlichen Vorstellung des Projekts mit Kafka vergleicht („Der hatte auch immer Angst, Sachen zu veröffentlichen.“), hat sich sein Staunen in drei Jahren Arbeit mit Geflüchteten bewahrt und ist gleichzeitig extrem routiniert. Eine gute Mischung, die es ihm erlaubt, seinen Mitmenschen mit einem gesunden Maß an Naivität, aber auch mit Selbstverständlichkeit zu begegnen. Eine Mischung, die ihm sicherlich dabei hilft, Barrieren zu überwinden. Und eine Mischung, die für viele Zuhörer des Abends gar nicht so selbstverständlich ist: Man ist interessiert an und offen gegenüber Neuangekommenen und Neuem. Doch wie kommt man ins Gespräch, wie lassen sich Berührungsängste überwinden? Das sind Fragen, die bei Meet your neighbours-Veranstaltungen und den Gesprächen im Anschluss immer wieder auftauchen.

Die Illustratorin Annemarie Otten hat Kunstpädagogik studiert. Seit zwei Jahren ist sie bei wolkenschlösser vor allem für zeichnerische und malerische Workshops verantwortlich. Bevor sie junge Geflüchtete dabei unterstützte, Erfahrungen und Erlebnisse anhand von Comics und Zeichnungen zu verarbeiten, hat sie sich im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit im Fach Kommunikationsdesign mit der Fluchtgeschichte ihrer Großmutter befasst, die aus dem rumänischen Banat stammt. Otten liest den ersten Teil ihrer in der Ich-Perspektive geschriebenen Graphic Novel „Elternerde“, dazu werden Zeichnungen von „Ich, Anna, 5“ , „Meine Mutter, Marianne“, „Peter (8 Monate)“, „Maria (3)“ und „Johann (7)“ auf Leinwand projiziert. Auch wenn man bei den ersten Bildern und Zeilen noch feststellt, dass es gar nicht so leicht ist, sich anhand des Genres Graphic Novel ins Jahr 1943 und in eine in Rumänien geborene deutsche Fünfjährige zu versetzen, entwickelt die Geschichte bald ihren Sog. Und stellt unausgesprochene Fragen in den Raum, an einem Abend, der Biografien, Geschichte(n) und Erfahrungen von ‚‘heutigen‘ und ‚damaligen‘ Geflüchteten vereint. „Eltern-Erde“ wurde 2014 veröffentlicht, im Gründungsjahr von wolkenschlösser, ein Jahr bevor über hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, darunter zahlreiche minderjährige. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass jede*r zweite der 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge im Heimatland und auf der Flucht so Schlimmes erlebt hat, dass er*sie als seelisch schwer belastet gilt. Welche Gemeinsamkeiten haben diese ’neuen‘ Geflüchteten mit den Flüchtlingen ‚unserer‘ eigenen Geschichte? Wie beeinflussen die Fluchterfahrungen der Deutschen ihre Einstellungen zu den Flüchtlingen von heute? Und wer kann von wem lernen und wenn nicht, warum?

Pa Modou aus Gambia lebt seit drei Jahren in Deutschland und ist wolkenschlösser-Teilnehmer der ersten Stunde. Mit einem vom Who-is-Who der Geisteswissenschaften nur so überbordenden Text liefert er ein überzeugendes Statement zum Thema übertriebene Berührungsängste, Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und Generationenkonflikt:
In „Nobelpreisgespräch“ setzt er sich mal eben mit „einigen verrückten Freunden“, darunter William Shakespeare, Isaac Newton, Galileo und Goethe an die Isar und lässt das Radio verkünden, „dass Albert Einstein den Nobelpreis für seine revolutionäre moderne Physik gewonnen hat“. Zumindest der Ich-Erzähler freut sich aufrichtig für Einstein „Waaw, gratuliere Buddy“, sagt er. Doch schon fühlt sich Isaac Newton ungerecht behandelt, William Shakespeare will einen aufkommenden Streit schlichten, wird dabei aber von Wolfgang Goethe zurechtgewiesen: „Halt dein Maul!! Du hast hier gar nichts zu sagen!“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs wiederum macht sich Susanne Eger „deutsche Dichterin, Schriftstellerin und Verfasserin des Leipziger Kochbuchs“, über Shakespeare lustig und wird dafür von Elizabeth Augustin zurechtgewiesen: „Hallo! Susanne sei nicht so respektlos, sie sind deine Ältesten!“ – woraufhin der Ich-Erzähler die illustre Schar ermahnt, das Mobbing zu beenden.
Pa Modous zweiter, wesentlich assoziativerer und gleichzeitig schlüssiger Text an diesem Abend sind seine „The I and I Whatsapp Philosophies“, geschrieben und vorgetragen auf Englisch. Pa Modou ist überzeugter Social Media- und sogar Internet-Skeptiker. Er möchte keine Fotos von sich ins Netz stellen, aber keinesfalls auf den Messaging-Dienst verzichten, der ihm zur Kommunikation dient, aber auch Baustein seiner kreativen Arbeit ist. Ständig wechselt er sein Profilbild und vor allem seine Statusmeldung – meist ein Zweizeiler zu einer konkreten Stimmung, einer Schlagzeile, einem Ereignis oder Gedanken. Diese Zweizeiler hat Pa Modou gesammelt, nach Themenkomplexen sortiert und kunstvoll miteinander verbunden:
But i heard the i and i say, my vision is longer than the river Nile and my dreams are bigger than the i and you can imagine
But the Most- high not him, her, he, she, or it but the i call it, guide our steps. Acceptance is my Philosophy only then you can make a change.
There should be no intimidation in education, because our knowledge has its origins in our perceptions. So teach the children to be wise and smart
Be open minded, spread love und compassion. Pay tributes to those people who positively influence you in your endeavors.
Beware of plastic smiles around you some of them are not real
And remember that there is no better legacy than being human.
Pa Modou, heute 19, mit 16 Jahren von Gambia nach Deutschland gekommen, scheint in vielen Sprachen und auch Künsten zuhause‚ und er ist – Humanist. Die Lanze, die er während seines Vortrags, mal nüchtern lesend, mal predigend, mal singend, für Menschsein und Menschlichkeit bricht, bricht er später im Gespräch auch für die Literatur. „Sie darf nicht sterben. Was soll denn sonst aus zukünftigen Generationen werden?“ fragt er, und gleichzeitig betont er, dass Schreiben seine Leidenschaft ist. Im Gespräch mit Nora Zapf findet er sogar eine nüchterne Formel für das, was ihn so bewegt: „Die Transformation von Gefühlen mit Hilfe von Grammatik und Sprache“, die für ihn ganz eindeutig keine berufliche Option ist. Genauso wie das Musikmachen. Gerade ist er dabei, im Tonstudio von Refugio München ein Mix-Tape zu erstellen, Lieder mit eigens geschriebenen Texten, die er über Beats singt. Alles (nur) Hobby – deshalb ist er auch froh, dass er an der Münchner SchlaU Schule seinen Qualifizierten Hauptschulabschluss machen konnte und sich derzeit zum Industriemechaniker ausbilden lässt, einen Beruf, den er richtig gut findet und den er auch ausüben will.

Khalaf Almohamad lebt erst seit Anfang 2016 in Deutschland und er singt ein Loblied auf München, „die beste Stadt in Deutschland“, auch wenn er zugibt, Kassel als einzigen Vergleich zu haben. Nachdem er 2014 Syrien und damit auch seine große Familie verlassen musste, lebte er eineinhalb Jahre in der Türkei. Eineinhalb Jahre, in denen er, wie er sagt, viel Zeit hatte, wenig Austausch und nichts zu tun. Also tat er das, wozu sein Onkel ihn schon als Kind motiviert hat. Dieser hat die Straßen, Mauern, Laternenmasten seiner Stadt „markiert“, mit kleinen Schriftzügen und vor allem Zeichnungen. Khalaf wuchs in einem kleinen Dorf auf, doch schon als Achtjähriger ging er durch die Straßen Aleppos und konnte genau erkennen, wo sein Onkel seinen letzten „tag“ hinterlassen hat. In der Türkei zeichnet Khalaf mehr denn je und er beginnt zu schreiben. Geschichten und Gedichte. Einige seiner Bleistift-Zeichnungen werden während seines Gesprächs mit Nora Zapf auf Leinwand projiziert: Selbstporträts, Porträts von Freunden und Freundinnen, von Annemarie Otten, mit der er auch in einem Workshop zusammengearbeitet hat, und von seinem Lieblingstier, dem Pferd.
Als Khalaf Almohamad schließlich ein Gedicht auf Arabisch vorträgt, herrscht Stille im Raum. Und sie hält an, als Nora Zapf die Übersetzung von Peter Tarras liest. Ein Auszug:
Eines Tages werde ich an einen Ort gehen, den ich nicht kenne.
Aber es wird alles so sein, wie es sein sollte.
Als Mensch werde ich einen Wert haben
ein Recht haben auf Respekt
eine Person sein, in der Gesellschaft etwas
bewegen
Tun, was ich möchte, ohne dass jemand sagt:
Halt! Das ist verboten, das geht nicht
Das ist nichts für dich, das ist eine rote Linie,
die nicht überschritten wird
Und das und das und das und das …
Genug mit Euren Lügen, Unwahrheiten,
Witzen, Spekulationen
Dass ihr mir sagt, was ich tun soll
Ich bin es, der entscheidet
Ihr verdreht nur die Wahrheit,
kleidet Verderben in schöne Kleider
Ihr denkt über Menschen wie Vieh,
führt sie an wie zur Schlachtbank
Ich habe mich heute entschieden
Ihr habt euren Tag, doch ich habe meinen
ihr habt, was ihr habt, ich habe meinen Stift
ihr habt euer Recht, ich habe meinen Herrn,
wie könnte Er mich vergessen?
2.
Auf’s Neue beginne ich heute eine Seite,
sitze alleine da und versuche zu lernen
Doch ohne Erfolg.

In München, erzählt Khalaf Almohamad, ist er längst nicht so allein, wie er es in der Türkei war. Hier hat er Freunde gefunden. Er spricht kein Englisch, was das Deutsch-Lernen vielleicht sogar etwas beschleunigt und längst lernt er nicht mehr nur, erzählt Sebastian Planck nach der Veranstaltung, sondern lehrt auch, ist nicht mehr Workshop-Teilnehmer, sondern unterrichtet selbst Geflüchtete. Er bringt ihnen das Zeichnen bei, zum Beispiel im Welcome Café der Münchner Kammerspiele. Außerdem wird er von „wolkenschlösser“ gerade zum neuen Bob Ross aufgebaut. In kleinen Videos gibt er Zeichen-Stunden in deutscher Sprache, das Ganze ist arabisch untertitelt und demnächst auf youtube zu sehen sowie auf Facebook und Instagram. Doch auch Khalaf sieht sich nicht wirklich als Künstler, er zeichnet und schreibt, um seine Gefühle auszudrücken, und ‚lernen‘ bedeutet für ihn auch wirklich ganz klassisch lernen. Auch er würde gerne seinen Quali machen und eine Ausbildung, doch noch besteht diese Möglichkeit nicht.
Die Protagonisten an diesem Abend sind so unterschiedlich wie ihre derzeitigen Lebenssituationen: In ihren Werken unternehmen sie den Versuch, Geschichte und Geschehenes eins zu eins abzubilden, sie spielen mit Parodie und Ironie, sie postulieren ein besseres Leben. An einem Abend präsentiert, zeichnen sie das weite Spektrum des Themas „Ankommen“. Und dabei wird klar: Ankommen kann nur, wer auch angenommen wird. wolkenschlösser können dabei eine große Hilfe sein.

Magic is here – im Literaturhaus München stellt Meet your neighbours die Zeitung NeuLand vor
Beim Meet your neighbours-Abend am 3. Mai im Münchner Literaturhaus trafen Sandra Hoffmann und Denijen Pauljević auf Autor*innen und Redakteur*innen der Zeitung NeuLand, die seit 2015 Geflüchteten die Möglichkeit bietet, sich ungefiltert zu Wort zu melden und in den Dialog mit den bereits hier Lebenden zu treten.

Zum ersten Mal fand in München eine Veranstaltung der Begegnungs-Reihe im Literaturhaus statt. Ursprünglich sollte der Abend räumlich und thematisch in die sehr sehenswerte Ausstellung Refugees. Eine Herausforderung für Europa von Herlinde Koelbl eingebettet sein. Wegen der vielen Voranmeldungen wurde er jedoch schon vorab ins Foyer im 3. Stock verlegt. So konnten Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen beim zehnten Mal WIR MACHEN DAS in München die eindrucksvolle Kulisse aus Abendhimmel, Dächern und verhüllter Kirchenkuppel genießen. Über 100 Personen waren gekommen, um die NeuLand-Zeitung und ihre Autor*innen kennenzulernen.
Das Gemeinschaftsprojekt NeuLand geht auf das Engagement einer Einzelnen zurück. Susanne Brandl, im Brotberuf journalistische Volontärin beim SWR, schilderte für das Publikum ihre Vision, die im Sommer 2015 einer spontanen Idee und ihrer eigenen Neugier entsprungen war: Was, so fragte sie sich, geht in den Menschen vor, die durch Flucht neu nach Deutschland kommen? Es ärgerte sie, dass in den meisten Medien der Fokus der Berichterstattung hauptsächlich auf den Fluchtgeschichten lag, mehr auf die Vergangenheit gerichtet war als auf das Hier und Jetzt. Auch hält sie das Opfer-Stigma des Geflüchteten nicht für hilfreich bei der Integration – und so war die Idee geboren: Den Neuankömmlingen durch das eigene Schreiben und dessen Veröffentlichung die Möglichkeit zu geben, sich selbst aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Inzwischen leitet Susanne Brandl das Projekt zusammen mit Raphael Müller-Hotop, unterstützt von knapp einem Dutzend Redakteur*innen, die im Tandem mit den Autor*innen an den Texten arbeiten. Vier Ausgaben der NeuLand-Zeitung sind bereits erschienen, die Startauflage von 8.000 Stück ist inzwischen auf 10.000 angestiegen. Die Zeitung liegt an vielen Stellen in München kostenlos aus, über die Internetseite von NeuLand kann man sich außerdem mit einem Klick die digitale Version herunterladen (in der aktuellen 4. Ausgabe sind die meisten der vorgestellten Texte enthalten).

Einfühlsam moderiert von Sandra Hoffmann und Denijen Pauljević lasen im Literaturhaus fünf der NeuLand-Autor*innen eigene Texte vor, was dem Publikum Einblicke in fünf verschiedene (Herkunfts-)Welten schenkte. Gleich der erste Autor, Adnan Albash aus Damaskus, nannte als Motivation für sein Schreiben die bessere Verständigung mit „den Menschen hier“. In Syrien hatte der Medizinstudent noch keinen Drang zum Schreiben, hatte auch neben Schule und Studium gar nicht die Muße dazu. Sein Text über die unterschiedliche Verwendung des Wörtchens „Nein“ in Syrien und in Deutschland sorgte für viele Lacher. Die deutschen Leser*innen werden darin ermuntert, einem Gast aus einem fremden Land auch ein zweites Mal Speis und Trank anzubieten, selbst wenn das erste Angebot mit einem „Nein, danke“ ausgeschlagen wurde – vielleicht war das nur aus anderswo ganz normaler Höflichkeit. Um derartige kulturelle Fallstricke zu vermeiden, schreibt Adnan, der Anfang 2015 nach München gekommen ist, seine Texte inzwischen gleich auf Deutsch. Das sei leichter, als von einer Sprache in die andere zu übersetzen, sagte er. Gratulieren kann man ihm aktuell auch zur frisch bestandenen Deutschprüfung für die Aufnahme an der LMU – er hofft nun, dort ab Herbst sein Studium fortführen zu können.
Ebenfalls mit einer guten Prise Humor ging es weiter mit James Tugume, im November 2014 aus Uganda nach Deutschland gekommen. In seinem Text Magic is here lobt er das Wunder der deutschen Krankenkasse. Die rettete ihn gleich zu Beginn seines neuen Lebens hier, als ihm nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einer Glastür die Schneidezähne ersetzt werden mussten. In Uganda, so berichtete er, habe man als „Krankenversicherung“ allenfalls eine Kuh, ein Motorrad oder ein kleines Grundstück, das man im Fall einer Erkrankung verkaufen könne. „Es ist aber auch gar nicht so leicht, etwas zu verkaufen, wenn man schwer krank ist oder einen Unfall hatte“, ergänzte er. James liebt alles, was mit Sport zu tun hat (was auch seine Armmuskeln zeigen!) und arbeitet inzwischen selbst als Asylberater in der Flüchtlingsberatungsstelle am Münchner Harras. Welche Schicksalsschläge er schon hinter sich hat, erzählte er ganz nebenbei: In seiner Heimat wurde er mit acht Jahren Vollwaise, lebte auf der Straße und später im Waisenhaus. Nach seinem Bachelor in Sozialarbeit, der ihm hier zum Glück größtenteils anerkannt wurde, arbeitete er später in derselben Einrichtung mit 32 Kindern.

Als nächstes kam Shirin Mirza Khalaf aus dem Irak auf die Bühne. Die erst 16-Jährige, die in die 8. Klasse einer Mittelschule geht, wurde von ihrem älteren Bruder Sultan begleitet, der auch an dem Text mitgearbeitet hat. Ihre ersten Worte: „Entschuldigung, dass Sie nicht lachen werden.“ Ein bezeichnender Satz für die Erfahrungen, die Shirin in ihrem Alltag immer wieder macht: Es ist nicht leicht, über das zu sprechen, was sie, ihre Familie und andere Jesiden im Irak seit 2014 erlitten haben und noch immer erleiden. Das Grauen wird beim Zuhören schnell unerträglich. Stark bewegt und zugleich selbstbewusst trug Shirin ihren bedrückenden Text dennoch vor – „Tut mir echt leid, das ist unsere Wahrheit“, betonte sie immer wieder – und antwortete auf Sandra Hoffmanns Fragen. An dieser Stelle ließ sich übrigens ein schönes Zeichen für ihre gelungene Integration nach zwei Jahren in Bayern bemerken: Auf Sandras Hinweis, man müsse auch nicht weitersprechen, als sie sieht, wie Shirin mit den Tränen ringt, erwidert diese spontan: „Passt schon.“ Man würde es jedem jungen Mädchen wünschen, sich nicht mit solchen Themen befassen zu müssen, aber für Shirin ist die Verfolgung und Unterdrückung der Jesiden im Irak durch den IS schon jetzt ein Lebensthema geworden. Sie sprach speziell für die Frauen, die vergewaltigt und zur Sklavenarbeit gezwungen werden. Hier in Deutschland fühle sie sich nun sicher, sagte aber auch ganz klar: „Egal, wo wir einmal leben, egal, wie glücklich wir einmal sein werden: die Gefühle und die Erinnerungen an das Schreckliche bleiben in Kopf und Herz.“

Asef Naderi aus Afghanistan, seit 2013 in München und aktuell Auszubildender in einem Dentallabor, stellte anschließend die Frage nach Korruption in Deutschland anhand einer Abzocke durch einen Busfahrer. Auch sonst zeigte sich der ernste junge Mann, der sich in seiner Freizeit für die kuriose Mischung aus Mathematik, Chemie und Bollywood-Filme interessiert, als kritischer Geist, in einem anderen seiner Texte geht es um gerechte Bezahlung auch für (eingewanderte) Aushilfskräfte. Sein Traum: „Irgendwann mal den Iran bereisen zu können. Auf meiner Flucht habe ich gesehen, dass es ein sehr schönes Land ist.“
Zum Schluss las die Sozialpädagogin Munkhjin Tsogt aus der Mongolei einen Motivationstext, wie es gelingen kann, seine Träume in Deutschland zu verwirklichen. Auch wenn es ihr anfangs nicht leicht gefallen ist, sich auf die neuen Lebensumstände einzustellen (wobei sie im Unterschied zu den Neuankömmlingen aus südlichen Ländern nicht über das Wetter klagt, „schließlich komme ich aus der kältesten Hauptstadt der Welt“) – nach fünf Jahren hier fühle sie sich inzwischen so heimisch, dass sie der ersten Reise in ihre alte Heimat, die sie in diesem Jahr vorhat, mit gemischten Gefühlen entgegensieht. Mit ihrem kleinen Sohn auf dem Schoß erzählte sie auch, wie sie zu NeuLand gekommen ist: „Ich habe in der Bibliothek ein Exemplar der Zeitung gesehen und sofort eine Mail geschrieben.“

Über diese Rückmeldung freute sich Raphael, denn genau so soll es gehen – ein unbürokratischer Kontakt mit niedrigen Schwellen, der möglichst viele Neuankömmlinge motivieren soll, auch die eigene Stimme, den eigenen Blick und die eigenen Erfahrungen mit anderen zu teilen. Für Pluralität und gegen die Ängste, die es auf allen Seiten gibt und die durch konventionelle Medien leider oft eher noch geschürt werden. Davon wissen auch die NeuLand-Autor*innen ein Lied zu singen: James erster Text hieß Der Dschungel ist hier – Gedanken dazu, dass man in der Fremde meist zuerst das Gefährliche sieht –, und Adnan sagt: „Die Leute wissen nur aus den Nachrichten etwas über uns und unsere Länder, und in den Nachrichten wird nur über Schlimmes berichtet.“
NeuLand ist ein Gegenpol dazu. Durch das Erzählen wird Nähe geschaffen, das Verbindende wird stärker spürbar als das Trennende. Tatsächlich ist es eine besondere Erfahrung, beim Lesen der NeuLand-Zeitung ausschließlich Berichte aus der Eigenperspektive der Geflüchteten zu lesen, kein noch so wohlmeinendes „Über“. An diesem Abend wurde – ganz im Sinne der Meet your Neighbours-Reihe von WIR MACHEN DAS –, sehr deutlich, wie reich es macht, miteinander statt übereinander zu reden. Und wie essentiell es für die Integration ist, dass Mensch auf Mensch trifft und die Neuankömmlinge feste Bezugspersonen haben, wurde an dem Dank deutlich, den jeder der Autor*innen nicht nur allgemein, sondern auch persönlich an eine Lehrerin, einen Lehrer, eine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin oder die Redakteur*innen von NeuLand richtete. In diesem Sinne galt auch für diesen Abend im Literaturhaus: Magic is here.

Weil Orte dazu verlocken, sich an sie zu gewöhnen
Meet your neighbours im Rahmen eines Kulturfrühstücks in der Stadtbibliothek Pasing: Am 14. Mai traf Fridolin Schley den syrischen Dichter und Journalisten Yamen Hussein zum interkulturellen Dialog mit „Blickpunkt Syrien“. Sie lasen alte und neue Gedichte und sprachen über den fortwährenden Prozess des Ankommens im neuen Land.

Im September 2016 war Yamen Hussein schon einmal bei Meet your neighbours zu Gast (hier zum Nachlesen). Beim vom Kulturforum München-West und der Münchner Stadtbibliothek Pasing organisierten Kulturfrühstück sitzen er und Fridolin Schley nun zum zweiten Mal gemeinsam auf der Bühne, wieder unterstützt von Marwa Amara als Dolmetscherin. Gleich als Erstes fällt auf, wie sehr sich Yamens Deutsch im letzten halben Jahr verbessert hat – nur bei komplexen Fragen greift er auf Marwas sprachliche Hilfe zurück, alles Allgemeine beantwortet er diesmal gleich selber, und auch wenn er das bescheiden abtut: Fridolin Schley greift nicht zu hoch, wenn er Yamens Deutsch als „kolossal“ und „fulminant“ bezeichnet. Das Zuhören macht Freude und der Funke springt sofort über, eine große Sympathiewelle aus dem Publikum schwappt gleich zu ihm zurück. Rund 60-70 Personen haben an diesem sonnigen Sonntagvormittag trotz Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke den Weg in das gemütlich mit Bierbänken bestückte Foyer der Stadtbibliothek Pasing gefunden.
Das Gespräch geht gleich in medias res: Yamen bestätigt, dass sein Leben in Deutschland dankenswerterweise weiterhin sicher ist und er durch das Writers-in-Exile-Stipendium des deutschen PEN, das noch bis Dezember läuft, viel Zeit zum Schreiben hat. Doch der Krieg in Syrien wirft weiter seinen Schatten auf ihn, schlimme Nachrichten lenken immer wieder ab, beeinträchtigen z.B. die Konzentration im Deutschkurs, vor allem jedoch bleibt die Sorge um die Familie in Syrien. Äußert Yamen sich hier, am neuen, sicheren Lebensort, öffentlich zu kritisch, kommt es vor, dass seine Eltern oder der Bruder, die noch in der Heimatstadt Homs sind, vom Geheimdienst oder von islamistischen Milizen bedroht werden. Er tut es trotzdem. Und es ist klar, dass sich die eigene Freiheit so nur schwer genießen lässt. Ein ständiger Balanceakt, das Leben zwischen den Welten, in der Gleichzeitigkeit der Lebensrealitäten.
Siebzehn Minuten
Die verbleibende Zeit,
bis die U-Bahn kommt,
die mich und einen Trinker
zu meiner Station bringt,
reicht für einen Liebesrausch,
reicht,
um ein Massaker zu begehen,
dass eine Scud-Rakete Rakka erreicht
und ein ganzes Wohnviertel zerstört,
dass eine Katze ihre Seele aushaucht
unter den Rädern eines Lastwagens,
dass ein Henker
sich die Spuren des Gehirns abwäscht,
das er am Mittag mit einer Axt zerschmettert hat.
Zeit genug
für ein weiteres
Glas Bier,
das dich über die Schwelle trägt
in den angenehmen Taumel
in den Rausch,
dass du tanzt wie ein Irrer.
Das veränderte Zeiterleben, das wiederholte Warten gehört zur Erfahrung der Flucht. Auch Yamen schreibt und spricht häufig davon. Dass zunächst nichts Schlimmeres vorstellbar ist, als weggehen zu müssen. Dann das Festhängen, in seinem Fall in der Türkei, die Ungewissheit, ob man es bis in die Sicherheit schafft. Das Vermissen der Lieben, der Geliebten. Und auch nach Ankommen in der Sicherheit ist das Leben nicht wie vorher. Stets spürbar im Großen, klar, aber auch im Kleinen. Die Freunde fehlen, das ungezwungene Miteinander (die Deutschen seien immer so sehr eingespannt in Arbeit und Alltag, klagt Yamen), sich spontan begegnen zu können, auch in der Sprache, alles erfordert Anpassung und Anstrengung. Ein Einleben, das trotzdem geschieht, gelingt – eine Lieblingszeile von mir dazu aus seinem Gedicht „Rastlosigkeit“: „Weil Orte dazu verlocken, sich an sie zu gewöhnen.“ Oder wie Yamen mit einer verzweifelten Grimasse sagt: „Trotz des Wetters.“ Besonders berührt hat mich rund ums Thema Exil Yamens Äußerung, er wünsche sich, solle er je nach Syrien zurückkehren können, sich dann noch einmal auf die Reise nach Deutschland machen zu können. Aber freiwillig.

Die Lage in Syrien ist von außen (und wie Yamen sagt auch für die Syrer selbst) nur schwer verständlich. Zu viele Parteien mischen mit, und die Interventionen von Putin wie Trump sieht Yamen mit der gleichen Desillusionierung. So fatal die politische Verfolgung im Land auch ist, Yamen berichtet, dass nach der Revolution im Assad-Regime auch schon Privates Anlass für Verfolgung sein konnte. Er sei einmal fast verhaftet worden, nur weil er seine Freundin auf dem Unigelände öffentlich geküsst hatte. Für ihn selbst wurde in diesen schweren Zeiten das Schreiben zunehmend eine Möglichkeit zur Verarbeitung.
Auch an seinem neuen Lebensmittelpunkt stellt sich nun die Frage, sich gesellschaftlich zu verorten. Auf Fridolins Frage, ob es ihn manchmal störe, speziell im Kontext Flucht zu Lesungen und Gesprächen eingeladen zu werden, ist Yamens Antwort eindeutig: Er wird nicht gern mit anderen in einen Topf geworfen, das mochte er schon in Syrien nicht. Zugleich liegt auf der Hand, dass er aus seinem Land flüchten musste und daher (zumindest momentan) der Exilliteratur zugeordnet wird. Grundsätzlich hofft er, dass sein Werk aufgrund der literarischen Qualität beurteilt wird, nicht nur als Fluchtstatement.
Morgen
Morgen wirst du ein Jahr älter
und die Entfernung zwischen uns
zur grausamen Bestie.
Morgen wachsen deine milchweißen Zähne ein Stück,
jene ersten, die noch nicht ausgefallen sind.
Deine lange Nase, die ich so liebe und die du hasst,
holt tief Luft,
stockt.
Deine dunkle Haut wird noch schöner,
ich sage dir das,
und in deiner Achselhöhle zeigt sich ein Salzfeld.
Waw! Ist das Herz aufgeregt, schwitzt der Körper.
Die Locke an der Stirn
wird auch ein Jahr älter
und lang wie das Haar an einem Maiskolben.
**
Du und ich
bringen einen bitteren Toast aus – auf das Leben,
jeder von uns in einem „Land“… Nein!
Das ganze Land bist du
und das Exil eine harte Nuss,
knackst du sie mit den Zähnen,
bricht sie entzwei.
**
Unser Los ist es, einen Strumpf in den Himmel zu werfen
und zu warten, dass der Geist des Festes
uns Geschenke bringt und die Wünsche erfüllt.
Morgen werfe ich einen Strumpf in die Luft,
warte auf deine Sterne
und fange sie auf
Stern für Stern.
Klare Worte auch zur AfD: Von der fühle er sich persönlich nicht bedroht, er sagt aber ganz zu recht: „Die AfD ist eine Gefahr für die ganze Gesellschaft, nicht nur für Flüchtlinge.“ Europa habe immer noch eine Vorbildfunktion für die Welt, hier müsse man mit den Wertefragen verantwortungsvoll umgehen. Eine politische Radikalisierung in Europa und verstärkter Nationalismus würde nur weiteren Nährboden für Extremisten bieten, genau wie in den islamischen Ländern. Man müsse sich bewusst sein, dass die Stigmatisierung immer wieder eine neue Gruppe treffen könne: „Früher die Juden, jetzt die Muslime, in Zukunft vielleicht die Homosexuellen oder Frauen.“ Deutschland sieht Yamen dabei weniger gefährdet als andere Länder in Europa, denn: „Die deutsche Geschichte ist eine gute Prävention.“

Seine Gedichte liest Yamen zuerst auf Arabisch, bevor Fridolin die Übersetzungen vorträgt. Eine Frau aus dem Publikum dankt explizit dafür, der Vortrag und speziell Yamens Körpersprache beim Lesen haben die Texte für sie noch auf einer weiteren Ebene erschlossen. Sie fragt nach dem Humor in seinen Texten, einer gewissen Leichtigkeit trotz der schweren Themen. Darauf lernen wir: Homs ist bekannt für Ironie und Humor, und die Bewohner der Stadt stehen im Ruf, das Leben leicht nehmen zu können. Sogar einen historischen Vorläufer gibt es dafür, der mit einem „Tag der Verrücktheit“ gefeiert wird, zurückgehend auf einen Krieg vor 1400 Jahren, der durch eine humorvolle Erzählung überwunden worden sein soll.
Yamen wünscht sich momentan vor allem, dass die Mutter einmal für ein paar Wochen zu ihm zu Besuch kommen kann. Sie sprechen möglichst jeden zweiten Tag miteinander, und die Mutter hat Angst, ihn vor ihrem Tod nicht noch einmal zu sehen. Die Gefühle, die in dem Gedicht „Skpye mit meiner Mutter“ (s. Artikel zur letzten Veranstaltung) beschrieben sind, kann das Publikum besonders gut nachvollziehen. Ein kollektives Seufzen geht durch die Reihen an diesem Sonntag, es ist Muttertag.
Für Yamen selbst bietet ein Verlagsstipendium für eine Publikation auf Arabisch eine berufliche Perspektive, daneben möchte er sein Deutsch weiter verbessern und stellt sich auch darauf ein, sich nach Ablauf des PEN-Stipendiums neben dem Schreiben einen Brotjob zu suchen. In München möchte er gern bleiben. Angebote sind willkommen, und aus Yamens Worten klingt durch, dass er sich auch über mehr Gespräche und Austausch mit Deutschen freuen würde. In der Bibliothek klappt das ganz hervorragend: noch lange spricht Yamen nach der Veranstaltung (beim köstlichen Imbiss eines libanesischen Caterers) mit interessierten Teilnehmer*innen.

Das Salz der flüchtigen Details
Es ist ein Ringen um die menschliche Würde, das die neuesten Texte syrischer Autorinnen und Autoren prägt. Die Übersetzerin Larissa Bender stellte bei Meet your neighbours am 1. Juni 2017 im Literarischen Colloquium Berlin die in Trier lebende Lyrikerin Rasha Habbal vor sowie den Dichter Yamen Hussein, der mit einem Writers-in-Exile-Stipendium nach München kam. Außerdem las Peer Martiny Miniaturen aus Niroz Maleks „Der Spaziergänger von Aleppo“.

Niroz Malek, so erfahren wir bei der Begrüßung, lebt und schreibt in Aleppo. Er ist nicht, wie die zwei Autor*innen auf dem Podium, aus seiner Heimat geflohen, als dort der Krieg ausbrach. An seiner Stelle lesen daher Yamen Hussein und der Schauspieler Peer Martiny auf Arabisch und Deutsch Miniaturen aus „Der Spaziergänger von Aleppo“ (Weidle Verlag). Schon nach der ersten gelesenen Erzählung wird deutlich, warum dieser Autor sein Zuhause nicht verlassen wollte, oder besser gesagt, es nicht konnte.
Ich ging in die Küche, blieb mitten im Raum stehen und
fragte mich wieder: Was hat dich jetzt in die Küche verschlagen?
Willst du dir selbst beweisen, daß die Kämpfe
nun in deiner Wohnung stattfinden? Ich wußte keine Antwort.
Beunruhigt kehrte ich in mein Zimmer zurück, um
weiterzuschreiben. Da fragte sie: Und? Willst du nicht wie
die anderen Leute Dokumente und Habseligkeiten für die
Flucht in deinen Koffer packen? Du unterscheidest dich
doch nicht von all den anderen, die aus den Stadtvierteln
fliehen, die bereits in Schutt und Asche gebombt wurden.
Ich sah sie an und dachte über ihre Worte nach. Dann
lächelte ich und erwiderte: Glaubst du wirklich, daß
ich meine Wohnung verlasse? Daß ich meinen Tisch zurücklasse,
an dem ich gearbeitet und meine Geschichten
und Romane geschrieben habe? An dem ich die Cover für
meine Werke entwarf und Hunderte und Aberhunderte
Bücher las? Ich sagte zu ihr: Ich werde meine Wohnung
nicht verlassen. Was immer auch geschieht, ich werde
nicht fortgehen.
Während Peer Martiny den Dialog des Spaziergängers mit angenehm ruhiger und dennoch kraftvoller Stimme liest, fällt mir ein Zeitungsartikel ein, den ich vor einigen Monaten gelesen habe. Darin ging es um einen älteren Mann, der lieber in seiner von Bomben zerstörten Wohnung in Aleppo bleiben wollte, als seiner Stadt und seinem Land, aber vor allem auch seinem Alltag den Rücken zu kehren. Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wo genau ich diesen Artikel gelesen habe, aber das Bild dieses Mannes zwischen all seinen Habseligkeiten sehe ich mit einem Mal ganz deutlich vor meinen Augen. Man kann die eigene Seele nicht einfach „in einen Koffer stopfen“. Flucht ist eine Option mit Risiko.
Das bestätigt auch die syrische Schriftstellerin Rasha Habbal an diesem Abend. Als die Übersetzerin und Moderatorin der Veranstaltung, Larissa Bender, sie darauf anspricht, dass sie mit einem ihrer Kinder aus Syrien „vorgeflohen“ ist und ihr Mann und das zweite Kind nachgeholt hat, ist ihrem Gesicht deutlich abzulesen, dass dies wohl eine der schmerzhaftesten Entscheidungen in ihrem Leben gewesen sein muss. Ursprünglich hatte sie diesen Weg allein gehen wollen, doch in der Nacht vor ihrem Aufbruch stand mit einem Mal eines ihrer Kinder an ihrem Bett und sagte: „Ich habe dir nicht erlaubt, mich allein zu lassen.“ Was soll eine Mutter in solch einem Moment tun? Im Konflikt mit sich selbst, ob sie ihr Kind im Stich lassen oder es den Strapazen einer gefährlichen Flucht übers Mittelmeer aussetzen soll, entschied sie, das Kind mit sich zu nehmen. Doch auch wenn sie es geschafft hat und ihre Kinder und ihr Mann inzwischen gemeinsam mit ihr in Trier leben, bedeutet dies nicht, dass sie kein Leben zurücklassen musste.
Eindringlich beschreibt sie in ihrer Erzählung „Scheckige Hände“ die auf Arabisch von ihr und in der Übersetzung von Larissa Bender vorgetragen wird, welche Erinnerungen die Handschrift ihres Vaters in einem Brief an sie hervorruft und welche Freude sie empfindet, als sie ein Paket von ihm erhält, eine Plastiktüte voller Erinnerungen an ihre Familie und das Leben in der syrischen Heimat. Eine „Wundertüte“, die sie auflachen lässt wie ein Kind. „Es waren Überraschungen, die dir Erinnerungen an Details ins Gedächtnis rufen, bis du zu keuchen beginnst, als liefest du zwischen den Wänden deines eigenen Körpers umher.“ Jedes noch so kleine Detail macht sie glücklich: der Geruch von Okraschoten, eine blaue Perlenkette und Ohrringe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte, sowie zwei Romane:
Der zweite Roman war aus der Bibliothek meines Vaters und trug eine Widmung von ihm:
»Du hast ein wenig von mir
Und ich habe viel von dir
Die Musik einer aufregenden Kindheit
Und der Schweiß der Tage
Wir haben nun etwas, das wir gut festhalten
Das Salz der flüchtigen Details …«
Die Details eines früheren Lebens. Die Details des Überlebens. „Ist es möglich, dass dein Leben in nur einer Viertelstunde an dir vorbeizieht?“, fragt die Erzählerin sich beim Anblick all der Erinnerungen. Am 17. Juni 2015, so schreibt Rasha Habbal, steht sie zum letzten Mal auf syrischem Boden, doch „was Füße mit Gewalt festhalten, sind Dinge ohne Distanz.“ Sie beschreibt ihren „störrischen Schatten“ während der Flucht, den sie streng erziehen musste und Ähnliches findet sich, anders geschrieben, auch in den Gedichten Yamen Husseins, wenn dieser von Fußreifen, schweren Gliedern und dem Weg durch die Unterwelt spricht.
FUßREIFEN
Deine Fußreifen klingen jetzt
wie eine laute Glocke
in vertrauten Tälern.
Selig sei diese Unterwelt
deine Schritte und der matte Klang
dein wie ein Reim gewichtiger Knöchel
meine Schafe gehen freiwillig
hinter dem Klang her
ohne Führung.
Es ist ein Weg zwischen Leben und Tod. Bei Habbal heißt es in einer ihrer Erzählungen, die an Tagebucheinträge erinnern, dass um sie herum alle tot seien, „ich glaube, ich auch.“ Ein Gedanke, der sich auch in einer Geschichte Maleks zeigt, in welcher der Protagonist nach einer Demonstration verhaftet, verhört und schließlich so lange gefoltert wird, bis er stirbt und fortan aus der Perspektive seines Leichnams berichtet: „Ich hatte das Leben ausgehaucht.“ Füße, Wege, Tod. Ist es das, was die drei Stimmen verbindet? Eine gemeinsame Sprache, Motivik und Erfahrung?
Man habe es hier mit düsteren Texten zu tun, bestätigt Larissa Bender, die zwischen den Lesungen das Gespräch mit ihren Gästen sucht, um eine Verbindung zwischen der Literatur, die sich größten Teils der syrischen Heimat und der Erfahrung von Flucht widmet, und den Erfahrungen in Deutschland zu schaffen. Wie werden sie als Autor oder Autorin hier in Deutschland wahrgenommen? Wie läuft es mit den Deutschkenntnissen und wie denken sie über den Begriff der „Fluchtliteratur“, der sich wie selbstverständlich unter unseren Wortschatz gemischt hat.
Rasha Habbal berichtet von skeptischen Blicken ihres Gegenübers während einer Zugfahrt, auf der sie auf Arabisch telefonierte. Bei Yamen Hussein ist das Problem ein anderes, denn er spricht inzwischen gut Deutsch, trifft in seinem Alltag in München allerdings kaum jemanden, der Zeit hat, sich mit ihm zu unterhalten. Als die Übersetzung dieser Aussage beim Publikum ankommt, geht ein Lachen durch die Reihen. Hussein wirkt wie ein angenehm entspannter Typ mit einem Sinn dafür, tragische Dinge lustig zu erzählen. Aber was ist eigentlich die angemessene Reaktion auf derartige Geschichten? Sollte ich Mitleid verspüren, wenn ich höre, was sie durchgemacht haben und nun in ihrem Alltag in Deutschland auf Ignoranz und Skepsis treffen?
Auf die Frage, wie sie als Autor*innen in Deutschland wahrgenommen werden, bestätigen beide, dass sie vor allem zu Veranstaltungen eingeladen werden, die unter dem Motto Flucht oder Syrien stehen. Veranstaltungen mit anderen (deutschen) Autor*innen, bei denen man sie einzig als Schreibende begreift, bleiben bislang aus. Stattdessen werden sie gefragt, über was sie denn schreiben würden, wenn es den Krieg nicht gäbe. Dann würden sie eben über etwas anderes schreiben. Sie sind Geflüchtete und Autor*innen. Das eine bedingt nicht das andere. Die Flucht, so erklärt Yamen Hussein, ist bei ihm momentan zwar der Auslöser zum Schreiben und es hilft ihm, die Erfahrungen, die er auf dem Weg von Syrien über die Türkei nach Deutschland gemacht hat, in seinen Gedichten zu verarbeiten. Doch die Fluchtliteratur gibt es in seinen Augen nicht. Es gibt die Literatur, egal ob von Autor*innen, wie Niroz Malek in Syrien oder von ihm und Rasha Habbal, die nun in Deutschland leben und schreiben.
Heiner, hör mir zu – so, wie ich dir zugehört habe
Mit Afraa Batous stellte Meet your Neighbours am 19. Juli bei Literatur Moths in München zum ersten Mal eine Künstlerin vor, die nicht in München lebt. Sie wohnt nach vier Jahren im Libanon und einigen Monaten in der Türkei seit 2016 in Nürnberg. Silke Kleemann und Denijen Pauljević zeigten Ausschnitte aus dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Skin“ und sprachen mit Afraa Batous über ihre Kunst, ihre Erfahrungen, ihre Pläne, ihr Gefühl des „un-belongings“, das sie mitnähme, wohin immer sie gehe.

Mit dem Text eines deutschen Dramatikers beginnt die ganz persönliche Erfahrung der syrischen Revolution für Afraa Batous. Die junge Theatermacherin las Heiner Müllers Hamletmaschine, war fasziniert von der grobschlächtigen Sprache, wie besessen von der Hauptfigur, die sich vom intellektuellen Revolutionär zum Gewalttäter wandelt. Das Stück transportierte genau die Emotionen und Bilder, die sie vom radikalen Umbruch im eigenen Land träumen ließen. Mit Freunden bereitete sie eine Aufführung des Stücks vor. „Wir dachten, wir könnten unsere eigene Revolution starten, wenn wir das Stück auf die Bühne brächten. Es fühlte sich gut an, weil wir im Verborgenen arbeiten mussten“, erzählt sie aus dieser Zeit. Und sie fügt sofort hinzu: „Wir waren naiv.“ Es war das Jahr 2010 in Aleppo. Ein Jahr später brach die Revolution aus. Die Aufführung konnte nicht mehr stattfinden. In Afraas Kopf blieben Heiner Müllers Worte und die Frage, ob sie verstanden hatte, ob sie jemals verstehen konnte, was ihr der Autor sagen wollte. Immer noch besessen vom Text griff sie zur Kamera und begleitete zwei ihrer Freunde aus der Theatercrew. Sie zeichnete über vier Jahre hinweg auf, wie sich ihre Leben ab da entwickelten. „Keiner konnte das auch nur erahnen“, so Afraa Batous rückblickend. So entstand ihr Dokumentarfilm „Skin“, den sie im Juli mit Silke Kleemann und Denijen Pauljevic bei Meet your Neighbours in München vorstellte.
Der Film beginnt mit ihrer Antwort an Heiner Müller: „Das Theater konnte nichts an dem ändern, was passierte, Heiner. Hör mir zu, wie ich dir zugehört habe.“ Ihre beiden Freunde, Hussein und Soubhi aus der Theatercrew, gehen unterschiedliche Wege – „Skin“ zeigt, wie sich die Beziehungen der drei untereinander und die persönlichen Einstellungen zur Revolution verändern. Während Soubhi beschließt, seinen Weg als Künstler weiterzugehen und für ein Kunststudium in den Libanon zieht, bleibt Hussein. Er berichtet als Journalist aus seiner Heimatstadt Aleppo in die Welt, kämpft letztendlich selbst auf Seiten der Freiheitskämpfer. Diese beiden Alternativen seien repräsentativ für die Wahlmöglichkeiten der intellektuellen Klasse Syriens: Gehen – um andernorts weiterzumachen und von einem Leben in Frieden zuhause zu träumen (wie Soubhi, der am liebsten eine Bar in Aleppo eröffnen würde) oder Bleiben – um mitzukämpfen bis zur letzten Konsequenz.
Mit langen Dialogen steigt „Skin“ ein. Revolution, Kämpfe und Zerstörung erahnt der Zuschauer nur durch Szenen einer kleinen Demonstration, durch Bilder von Ruinen. Hussein raucht, auf einem Plastikstuhl sitzend, den er auf den Trümmern eines eingestürzten Hauses platziert hat. Soubhi arbeitet im Libanon, Afraa besucht ihn gemeinsam mit Hussein, die drei gehen ausgelassen tanzen, weinen auf dem Heimweg im Taxi. Die Wende: Nach den Wahlen im Jahr 2014. „Genau dies ist eine der Schlüsselszenen des Films für mich“, meinte sie im Gespräch mit Silke Kleemann und Denijen Pauljević. Der Film wird hektisch, laut, die Kamera kann sich minutenlang nur noch um die eigene Achse drehen. Die Grenzen der Zumutbarkeit waren für Afraa Batous erreicht, als sich Baschar al-Assad zum Wahlsieger erklären ließ, während Menschen auf den Straßen Syriens tote Kinder aus Trümmern bargen. Vierzig Filmminuten nach den Szenen bei der Theaterprobe blicken uns zerstörte, von Hitze, Alpträumen und Kampf gezeichnete, aufgedunsene Gesichter an. Die Verwegenheit der Anfangsszenen ist etwas Anderem gewichen.

Silke Kleemann und Denijen Pauljević zeigten Ausschnitte aus Skin und sprachen mit ihr über ihre Filme, ihre Erfahrungen, ihre Pläne, ihr Gefühl des „un-belongings“, das sie mitnähme, wohin immer sie geht. Gleich zu Beginn meinte Afraa Batous: „Wer nicht gesehen hat, was wir gesehen haben, für den werden es immer nur …“, und sie zeigte mit einer ausladenden Geste auf die Regale um sich herum „… immer nur Bücher bleiben.“ „Skin“ zu drehen, wurde für sie zu einem permanenten Balanceakt zwischen dem, was sie zeigen wollte, und der Zumutbarkeit für die Zuschauer.
Für Besucher des Abends im Moths, die sich mit geflüchteten Menschen und dem Wandel unserer Gesellschaft auseinandersetzen, brachte der Film und das Gespräch zwischen Afraa, Denijen und Silke auch eine neue Perspektive. Weil im Film gezeigt wird, dass die zu uns geflüchteten Menschen keine gesichtslosen Opfer sind, die hier Hilfe erwarten – sondern Individuen, die in ihrer Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, manche bewusst, manche aus Mangel an Alternativen, dass sie eine Geschichte mitbringen, die sie nicht an der Grenze abgeben können. Der Film hält das Reflektieren darüber fest und zeichnet behutsam eine Entwicklung nach, die, so Afraa, niemand ahnen konnte, als sie zu filmen begann: „Ich hätte nie gedacht, dass in meiner Stadt so etwas passieren kann, ich kannte die Bilder doch auch nur aus dem Fernsehen, aus meinen eigenen Alpträumen, aus dem Text.“
 Afraa, Soubhi und Hussein handeln, sehen sich teils als Mitauslöser von Revolution und all dem, was diese mit sich brachte und fragen sich rückblickend, was sie hätten anders machen sollen. Die Bilder von zerstörten Straßen und unberührtem Land, das viele Rot, das aus Alpträumen den Weg in den Tag findet, das Schweigen angesichts mancher Fragen, Husseins Kampf für die Befreiung seines Landes, Soubhis künstlerische Auseinandersetzung mit gebrochenen Gestalten, seine Sehnsucht nach einer guten Zukunft in der Heimatstadt Aleppo und Husseins Entsetzen darüber, sich trotz jahrelanger Hingabe nach der Flucht wie ein Verräter zu fühlen – all das eingerahmt durch Afraas eigenes Hadern mit dem Text Heiner Müllers, dem Sinn und Irrsinn von Revolutionen. Der Film hat viele Ebenen, die sich an manchen Stellen auch tatsächlich bildlich überlagern, wie Annika Reich (Initiatorin von Wirmachendas.jetzt, zu Gast aus Berlin), im Gespräch danach bemerkte.
Afraa, Soubhi und Hussein handeln, sehen sich teils als Mitauslöser von Revolution und all dem, was diese mit sich brachte und fragen sich rückblickend, was sie hätten anders machen sollen. Die Bilder von zerstörten Straßen und unberührtem Land, das viele Rot, das aus Alpträumen den Weg in den Tag findet, das Schweigen angesichts mancher Fragen, Husseins Kampf für die Befreiung seines Landes, Soubhis künstlerische Auseinandersetzung mit gebrochenen Gestalten, seine Sehnsucht nach einer guten Zukunft in der Heimatstadt Aleppo und Husseins Entsetzen darüber, sich trotz jahrelanger Hingabe nach der Flucht wie ein Verräter zu fühlen – all das eingerahmt durch Afraas eigenes Hadern mit dem Text Heiner Müllers, dem Sinn und Irrsinn von Revolutionen. Der Film hat viele Ebenen, die sich an manchen Stellen auch tatsächlich bildlich überlagern, wie Annika Reich (Initiatorin von Wirmachendas.jetzt, zu Gast aus Berlin), im Gespräch danach bemerkte.
Das Theater, es konnte nichts ändern. Doch Afraa arbeitet weiter, dreht – parallel zu WG-Suche und Deutschunterricht – bereits den nächsten Film.

Neue Stimmen der arabischen Literatur
Die Berliner Schriftstellerin Tanja Dückers stellte bei Meet your neighbours am 19. Oktober in der Kölner Stadtbibliothek die in Trier lebende syrische Lyrikerin Rasha Habbal und Galal Alahmadi, einen der bekanntesten Dichter des Jemen, vor und berichtet hier über den Abend.

Der große Saal der Zentralbibliothek in Köln ist einfach riesig, ein bisschen verloren sehen unsere Gäste hier aus. Aber die Stimmung ist gut: Freunde und Bekannte von Galal Alahmadi und Rasha Habbal, ein paar Arabisch-Studenten sowie interessierte Kolleg*innen von mir und den Veranstalter*innen vor Ort sind gekommen – der Raum ist trotz seiner Größe von lebhaften Gesprächen in Arabisch erfüllt.
Auf der Bühne geht es bald um die Unterschiede zwischen dem Schreiben zuhause, in der Heimat, und dem Scheiben in der Fremde – oder neuen Heimat – Deutschland.
Larissa Bender, die wir zum Glück für die Veranstaltung gewinnen konnten, übersetzt in sagenhaftem Tempo. Sie hat auch (sehr gut) die auf Weiter Schreiben publizierten Gedichte von Rasha Habbal übersetzt, was sie für diesen Abend erst recht zu einer perfekten Partnerin macht.
Wie hat sich der Ortswechsel auf das Schreiben ausgewirkt – inhaltlich, stilistisch? Während Rasha Habbal meinte, sie hätte nicht „so weiterschreiben“ können und in ihren Texten, ähnlich wie Ramy Al-Asheq zum Teil stark das eigene Erleben vor oder während der Flucht thematisiert (Rasha Habbal liest unter anderem ihren eindrucksvollen Text Kinder singen in einem kleinen Schutzbunker), ist für Galal Alahmadi das Schreiben eher ein unberührter Schutzraum im Kopf – er glaubt, dass seine Themen die gleichen geblieben sind, das ist ihm wichtig. Oft handeln seine Gedichte von „universellen Themen“, Einsamkeit, Sehnsucht, Selbstbefragungen. Auch meint er, dass Schriftsteller lange brauchen, um auf solche existenziellen Umwälzungen adäquat zu reagieren. Auf die Frage, ob er seine Texte nicht oft sehr melancholisch findet, meint Galal, dass er versucht, alle seine Melancholie in die Texte einfließen zu lassen, gewissermaßen dort zu „parken“, und dass er eigentlich ein sehr glücklicher Mensch sei. Etwas von diesem Glück kann man in den Gedichten (wie z.B. Zuhause), die wir vortragen (Galal auf Arabisch, ich auf Deutsch) erspüren – vor allem in der überbordenden Phantasie, in den vielen Momenten des Zauber- und Rätselhaften. In seinen Gedichten Vom Krieg und Weniger Hass wird er jedoch politisch und prangert unter anderem, mit ebenso treffsicheren wie überraschenden Bildern, die Zerstörung der Kultur der Indianer an. Wichtig ist ihm, dass Gewalt überall vorkommt und kein Spezifikum des Nahen Ostens ist.
Ramy Al-Asheq, dessen Literatur sich weniger „introvertiert“ liest, berichtet von Schwierigkeiten, in seiner Heimat zu publizieren – Freiheit in der Themenwahl ist ihm wichtig. Viele seiner Texte sind explizit politisch und von gerade geballter Energie. Er liest Seit ich nicht gestorben bin, einen packenden poetischen Bericht über nichts Geringeres als das schiere Überleben. Wir sprechen auch über Abwab (zu deutsch: Türen), die erste arabischsprachige Zeitung von Geflüchteten und für Geflüchtete, die es in Deutschland gibt und deren Chefredakteur er war.
Rasha Habbal liest Scheckige Hände – ein sehr berührender Text, in dem sie sich an ihren Vater erinnert und sich fragt, was Heimat ausmacht. Möglicherweise der Geruch von Okraschoten? Oder die deutliche Erinnerung an die von der Weißfleckenkrankheit gezeichneten Hände des Vaters, die sich leitmotivisch durch den Text ziehen? Rasha Habbal hat eine knappe, eindringliche Diktion, amalgamiert wie Ramy Prosa und Lyrik. Sie berichtet auch noch von der Anthologie Ohne Worte? Mit anderen Worten. Texte von exilierten Autorinnen aus dem arabischen Sprachraum, in der sie gerade veröffentlicht hat und die von der Kölner Grafik-Designerin Uta Kopp sehr schön gestaltet wurde.
Das Publikum lauscht den Lesungen und Gesprächen mit großer Konzentration – eigentlich sollte die Veranstaltung nicht länger als zwei Stunden dauern, aber am Ende werden sehr viele Fragen gestellt. Unser Publikum ist zahlenmäßig heute nicht sehr groß (ca. 30 Gäste), aber dafür ist das Interesse an den drei Autor*innen umso größer. Am Ende müssen uns die Techniker hinauswinken. Als ich gehe, kommt mir der Saal nicht mehr leer vor. Er ist voller gesprochener Worte, voller Leben.
Danke an Galal, an Ramy und an Rasha!
Hier noch einige Bilder von Almut Elhardt:
Schaut man sich die Welt an, darf Protest kein Sonderfall sein
Am 13. November stellte Meet your neighbours in München die Arbeit des Vereins Flüchtlingspaten Syrien vor. Heike Geißler war dabei. Ihr Bericht ist ein Plädoyer für mehr Mitgefühl und Solidarität. Und ein Aufruf zum Protest.
Text: Heike Geißler
Foto: Johannes Gerblinger

Teil 1. Ich berichte über einen Abend der Reihe Meet your neighbours in der Münchener Buchhandlung Buch in der Au und es geht um Geld .
Ein Menschenleben, heißt es, ist unbezahlbar. Ulrich Karpenstein, Mitbegründer des Berliner Vereins Flüchtlingspaten Syrien e.V., bringt es am 13. November bei Meet your neighbours anders auf den Punkt: „Ein Kind zu retten, kostet 450 Euro pro Monat, das ist ein Freikauf aus dem Krieg. 450 Euro kostet ein Kind, 650 Euro ein Erwachsener, und sobald wir wieder monatlich 450 Euro zusammen haben, (was bedeutet, dass sich 45 Spender*innen finden, die monatlich 10 Euro überweisen) geht die Schranke auf, wir unterschreiben eine Bürgschaft, haben wieder ein Kind aus Aleppo rausgeholt.“
Ulrich Karpenstein erzählt, er selbst habe lange Zeit die Augen vor dem Krieg in Syrien verschlossen, der Verein sei entstanden, nachdem er von einem Bekannten gefragt worden sei, ob er nicht die Familie seiner Schwester „rausholen“ könne. Das Rausholen ist jedoch nicht leicht. Es funktioniert nur über die wenigen verbliebenen Landesaufnahmeprogramme für Syrer*innen und die sogenannte Verpflichtungserklärung, eine Bürgschaft, mit der man sich vor ein paar Jahren lebenslang, nunmehr noch für fünf Jahre verpflichtet, gegebenenfalls für den Lebensunterhalt der herausgeholten Syrer*innen zu sorgen. Insofern diese Wohngeld oder Hartz IV beantragen, haftet man gegenüber dem Staat, und die dabei entstehende Summe kann „eine ganze Menge sein.“ Fünf Jahre Bürgschaft bedeuten bis zu 60.000 Euro, mit denen man pro Person einsteht. Die Kosten für die Krankenkasse übernimmt der Staat.
Karpenstein selbst hat lange darüber nachgedacht, ob er diesem Bekannten helfen möchte, bis er sich schließlich dafür entschied, eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Um die Finanzlast der Bürgschaften zu teilen, kam später die Idee zur Vereinsgründung auf. Der Verein Flüchtlingspaten Syrien entstand in geselliger Runde am Küchentisch und ist mittlerweile fast eine kleine NGO. Der Verein sei eine Art Staat und wird dafür vom Staat gemocht. „Wir machen“, sagt Karpenstein, „es allen furchtbar recht.“ Die durch die Flüchtlingspaten Syrien e.V. nach Deutschland geholten Menschen kosten den Staat nichts, und weil der Alltag der Neuankömmlinge von privaten Lots*innen und Bürg*innen etc. begleitet wird, verläuft die Integration in der Regel schnell und reibungslos. Ein Service, den der Staat nicht offiziell, tatsächlich aber bereitwillig und dankbar nutzt und immerhin in Aussicht stellt, die Zeit der Bürgschaft von den aktuellen fünf Jahren vielleicht auf zwei zu reduzieren. Natürlich geht man, insofern man sich für die Verpflichtungserklärung, also die Bürgschaft, entscheidet, das Risiko ein, für jemanden zu haften, den man gar nicht kennt. Man rettet aber auch, darauf weist Karpenstein hin, „unmittelbar ein Menschenleben. Binnen weniger Tage bekommen die Menschen ihr humanitäres Visum und landen ohne ein Schlauchboot besteigen zu müssen, ohne die Schlepper zu brauchen, in Berlin.“
Voraussetzung um Bürg*in zu werden, ist ein monatliches Nettoeinkommen von ca. 2.100 Euro (die Höhe des benötigten Einkommens variiert von Bundesland zu Bundesland). Klar ist, dass letztlich eher Wohlhabende das Risiko der Bürgschaft tragen können. Wenngleich das Risiko gering ist, denn alle eventuell entstehenden Kosten werden aus den gespendeten Geldern finanziert und die Bürg*innen werden erst zahlungspflichtig, wenn der Verein schlagartig keine Gelder mehr haben sollte. Wer lieber spenden als direkt bürgen möchte, kann dies auch tun: Über Kleinspenden in Mindesthöhe von monatlich 10 Euro finanzieren die Flüchtlingspaten Syrien e.V. weitere Bürgschaften.

Das Konzept des Vereins sei nicht, Vielen wenig zu helfen, sondern Wenigen viel zu helfen, wobei, so fügt es Katja Huber hinzu, die den Abend gemeinsam mit Andi Unger moderiert, es Viele verdient hätten, viel Hilfe zu bekommen. Zu helfen, und zwar so konkret zu helfen, wie es Freiwillige auf den Rettungsschiffen im Mittelmeer, in Kriegsgebieten oder auch aus der sicheren Stadt Berlin heraus wie die Flüchtlingspaten e.V. tun, heißt, erfahren und wissen zu müssen, wem und folglich: wem nicht geholfen werden kann. Bei der Entscheidung darüber, wer durch die Flüchtlingspaten Syrien nach Deutschland ausreisen darf, wird der Verein wesentlich von der Stiftung Wissenschaft und Politik unterstützt. Diese haben genaue Informationen, können, wie Karpenstein sagt, abschätzen, „in welchem Straßenzug demnächst geschossen wird und wo die Überlebenschance geringer als an anderen Orten ist.“ Der Verein selbst führt Auswahlgespräche mit den hiesigen Angehörigen, prüft den Integrationswillen, die Integrationsaussichten. Eine zügige Integration ist immer das Ziel, wer über die Flüchtlingspaten nach Deutschland kommt, muss schnell mit einem Sprachkurs beginnen und wird bei der Arbeitssuche unterstützt. Syrer*innen, die sich selbst finanzieren können, ermöglichen, dass ein weiterer Mensch aus Syrien ausreisen und in Deutschland leben kann. Ulrich Karpenstein nennt dieses auf schnelle Integration, auf zügige Unabhängigkeit von den Flüchtlingspaten zielende Prinzip „sehr hart, sehr rational.“ Es höre sich, „sehr unmenschlich an, weil es so wirtschaftlich ist, weil es ans finanziell Eingemachte geht, aber dadurch wird es uns ermöglicht, Menschen rauszuholen, die sonst keine Chance hätten.“ Und er sagt auch: „Absagen zu schreiben ist das Härteste, was es in diesem Verein gibt, aber gleichwohl die notwendige Aufgabe.“
Derzeit kümmert sich der Verein um 221 Syrer*innen. Man hätte nie gedacht, dass es so viele werden, aber es könnten auch mehr sein, sagt Karpenstein. Der Geldfluss in Richtung der Flüchtlingspaten Syrien e.V. stagniert jedoch: „Wir trommeln und trommeln und trommeln, aber mehr als 110.000 Euro haben wir bisher nicht.“ Dieses Geld, das den Flüchtlingspaten monatlich zur Verfügung steht, reicht, um für 221 Menschen zu bürgen. Eine Frau aus dem Publikum sagt, sie erzähle allen Freund*innen regelmäßig von diesem Konzept, alle finden es gut, aber niemand entschließe sich zur Spende. Warum aber ist das so? Karpenstein verweist auf die Antwort eines Ministerpräsidenten, der das Landesaufnahmeprogramm in seinem Bundesland stoppte. Der Ministerpräsident sagte, es seien zu Viele. Zu viele Fremde in der Gesellschaft. Landesaufnahmeprogramme für Syrer*innen gibt es nur noch in Berlin-Brandenburg, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hamburg. Vermutlich hat die Stagnation des Spendenflusses aber auch damit zu tun, dass die Hochzeit der Willkommenskultur längst vorbei ist, dass die Erregung über den Krieg in Syrien abgenommen hat; das ist die Konsolidierung des Außergewöhnlichen. Eben noch habe ich über die verhungernden Kinder im Jemen geweint, da explodiert eine Bombe in Kabul, und ich muss feststellen, davon nicht ergriffen zu sein. Ein ständiger worst case, ein worst case nach dem anderen. Wir brauchen das Neue, wir wollen vielleicht nicht denen helfen, die wir schon seit Jahren aus den Medien kennen. Offenbar. Immer muss eine neue Katastrophe unsere Spender*innenherzen erschüttern. Oder wir wollen die Garantie, dass unser Geld auch wirklich etwas bringt. Die sinnvolle Investition? Oder wir wollen unser Geld jetzt für uns behalten? Die überschaubare Investition? Ich weiß es nicht.
Karpenstein sagt: „Wenn wir Millionen hätten, könnten wir auch mehr rausholen. Wir sehen also tatsächlich, dass alles vom Geld abhängt.“ Das ist an sich eine schlechte Nachricht, und es ist keine neue. Aber natürlich ist es eine Nachricht, mit der man etwas Gutes anfangen kann.

Teil 2: Ich schweife ein bisschen ab und denke darüber nach, wie man sich nicht von seinesgleichen entsolidarisiert.
Ich sitze also an diesem 13. November bei Buch in der Au, sitze auf einem bequemen Sofa, mache mir Notizen. Ich sitze in der Buchhandlung, in der ich, als ich noch in München wohnte, immer meine Bücher gekauft habe. Mein Viertelbuchladen in Untergiesing. Wiedersehensfreude mit der Buchhändlerin Elisabeth Reisbeck. Ich genieße während der Veranstaltung das Sitzen im Buchladen, ich sitze da auch wie in meiner eigenen Vergangenheit, sitze wie in einer Möglichkeit, ich sitze so auf beste Art, neben meiner lieben Freundin Silke inmitten von Büchern, nach einem Treffen mit einer anderen Freundin im Wuid, das nur ein paar Eingänge weiter ist und montags das Bier zum halben Preis verkauft. Elisabeth Reisbeck sagt, ich sei überhaupt nicht älter geworden, was die willkommenere Variante des Brechtschen „Sie haben sich gar nicht verändert“ ist, ich erwidere das und frage, wie es dem Buchladen geht. „Gut“, sagt sie, und damit hatte ich nicht gerechnet, weil man so selten hört, dass es Buchhandlungen gut geht. Ich freue mich, kaufe später Ein Gott ein Tier von Jérôme Ferrari und Mitbringsel für meine Kinder bei ihr, denke aber ansonsten und sowieso die ganze Zeit darüber nach, wie man mit einem Unterfangen durchkommt, wie man ein Anliegen durchsetzt, wie man es verständlich formuliert.
Wie kann es gelingen, dass wir aus der nachvollziehbaren Abschottung vor schrecklichen Bildern, vor ungeheuerlichen Nachrichten aus anderen Ländern, Meeren etc., vor den Appellen an unser Mitgefühl, unsere Verantwortung als Bewohner*innen derselben Erde keinen Rückzug machen, dass wir uns nicht in das eigene Private stürzen, diese kleine Welt, die friedlich zu halten ohne Frage auch eine Aufgabe, und keine unwichtige ist, die aber nun einmal zugleich aufs Engste und Bedrohlichste mit der großen Welt verbunden ist. Wie bleibt man verbunden, empfänglich und handlungsfähig?
Ich will mich nicht entsolidarisieren, das Mitgefühl nicht aufgeben und nicht das Wissen darum, dass auch ich in einem Krieg leben könnte, fliehen müsste, schlimmer noch: mit meinen Kindern fliehen müsste und der Hilfe Fremder bedürfen könnte.
Erst recht will ich mich nicht entsolidarisieren lassen, will den Staaten nicht so viel durchgehen lassen wie bisher, wie stets. Was ich immer wissen und den Regierungen so oder ähnlich vortragen können müsste, ist dies: „Ungewollte Nähe und ungewollte Kohabitation sind demnach Bedingungen unserer politischen Existenz, sie […] beinhalten die Verpflichtung, auf der Erde ein Gemeinwesen zu leben, welches Gleichheit für eine Bevölkerung schafft, die notwendig und irreversibel heterogen ist. Ungewollte Nähe und ungewählte Kohabitation bilden auch die Basis unserer Verpflichtung, keinen Teil der menschlichen Bevölkerung zu vernichten und Völkermord als Verbrechen gegen die Menschheit zu ächten, aber auch, von Institutionen zu fordern, sich darum zu bemühen, alles Leben gleichermaßen lebbar zu machen.“ (1)
Diese Regierungen, die, während ich mich frage, warum Posts von Sea Watch, die ich ab und an teile, eigentlich niemanden interessieren, und was ich tun kann, um mehr Leute dafür zu interessieren, teuflische Pläne schmieden und menschenfeindliche Verträge in Brüssel oder Berlin oder wo auch immer unterzeichnen, handeln nicht in meinem Sinne. Sie beschließen Verträge, die Menschenrechte außer Kraft setzen, Diktatoren mit Waffen versorgen, Geflohene aus dem Stadtbild entfernen, in Unterkünfte oder Lager zwingen, die sie verwaltbar, übersichtlich, unsichtbar machen.
Wir brauchen eine Schule der Solidarisierung. Eine Schule des Mitgefühls. Nicht nur des Mitgefühls für Geflohene, für alle. Wir brauchen auch einen stärkeren Protest, eine Protestroutine. Einen in den Alltag integrierbaren Protest. Schaut man sich die Welt an, darf der Protest kein Sonderfall sein.
Aber natürlich is es in etwa so wie in diesem Gedicht von Rod Smith:
We work too hard
We’re too tired
to fall in love.
Therefore we must
overthrow the government.
We work too hard
We’re too tired
to overthrow the government.
Therefore we must
fall in love.
Ich bin jetzt übrigens Patin geworden, habe mich entschieden, monatlich 10 Euro zu spenden. Erst wollte ich nicht, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil ich dachte, dass den Syrer*innenn eh schon alle helfen (und es dabei besser wusste), vielleicht weil ich es unfair fand, dass die Syrer*innen im Vergleich zu anderen Geflohenen ein besseres Ansehen genießen, dass es für Syrer*innen Landesaufnahmeprogramme gibt, für andere Geflohene jedoch nicht. Weil mir einfach nicht gefiel und nach wie vor nicht gefällt, dass selbst der Mensch in Not eine Lobby braucht, dass alle Offensichtlichkeit des Überlebenskampfes etc. nichts bedeuten kann, quasi trotz aller Sichtbarkeit und Medienpräsenz wie nicht geschehend wirken kann.
Jede Katastrophe braucht, so ist es wohl, ein gutes Exposé, um der karitativen Jury aus Medien, Bevölkerung und Regierungen Wohlwollen und Hilfe zu entlocken. Aber, wie gesagt, wenn noch 44 Leute mehr mitmachen, kann ein Kind nach Deutschland kommen. Simple Mathematik. Kein Tropfen auf den heißen Stein. Ein Menschenleben.
(1) Judith Butler: Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung, S. 152.
Meet your neighbours zu Gast beim globale° Festival in Bremen
Schon zum 11. Mal fand im November das interkulturelle globale° Festival für grenzüberschreitende Literatur in Bremen statt. Es sind bekannte Autoren wie Michael Stavarič und Ilija Trojanow eingeladen – und auch hierzulande neue, vielversprechende Dichter wie Noor Kanj und Galal Alahmadi.

Das Café, in dem Galals und meine Veranstaltung stattfindet, ist ein schöner, uriger alternativer Ort mit gemütlichen Sofas und Sesseln. Im Publikum sitzen junge Leute, einige wohl von der Uni. An der Toilette steht statt den üblichen Mann-Frau-Schildern „EGAL“ und „Sexistische Kackscheiße“. Während ich mir noch überlege, wie ich Galal dies übersetze, beginnt schon die erste Veranstaltung im Rahmen des ganztägigen Workshops zum Thema Übersetzung, den Dr. Elisabeth Arend von der Universität Bremen leitet.
In den folgenden zwei Stunden geht es um die Gebärdensprache. Erst vor 15 Jahren – 2002 – wurde sie offiziell als eigenständige Sprache – und nicht nur wie bisher marginalisiert als Vehikel für Menschen mit einem „Defekt“ – anerkannt. Wir staunen anhand von Filmen wie Gedichte von Celan und Gomringer in Gebärdensprache übersetzt wurden und wie unterschiedlich verschiedene Interpreten diese Übersetzungen aufgeführt haben. Das performative Element lässt die Übersetzung zum gestisch-tänzerischen Ganzkörpererlebnis werden. Es geht auch umgekehrt: Gedicht-Performances in Gebärdensprache werden in Schriftsprache übersetzt. Und wir erfahren, dass die Gebärdensprache nicht international ist: So wurde neulich auf einem Kongress die kanadisch französische Gebärdensprache in die des europäischen Französisch übersetzt. Eine Art Esperanto der Gebärdensprache hat sich noch nicht richtig etabliert. Schon sind wir bei dem Thema Grenzen, Kulturräume und Beschränkung auf Nationalsprachen – was zu unserem Auftritt am Nachmittag sehr gut überleitet.
Vor Galal und mir sprechen die Berliner Schriftstellerin Tanja Langer und der aus Kabul zugeschaltete Kollege David Majed über ihr gemeinsam verfasstes Buch „Der Himmel ist ein Taschenspieler“, an dem sie drei Jahre, meist in verschiedenen Ländern, gearbeitet haben. Bald geht es weniger um praktische Aspekte dieser Doppel-Autorenschaft, sondern um kulturelle Unterschiede. Tanja Langer berichtet beispielsweise, wie sie sich von David oft „mehr Kritik“ an staatlichen Repräsentanten – wie Diplomaten – gewünscht hätte. In Deutschland würde man gern einen kritisch-ironischen Blick auf alles „Offizielle“ und Staatstragende werfen. David hätte hier mehr Respekt und hätte den Tonfall nicht ändern wollen. Hinzu kam, dass er sich mit allzu saloppen Äußerungen nicht in Afghanistan gefährden wollte. Tanja Langer wiederum wäre gern nach Afghanistan gereist, aber die soziopolitische Situation war ihr zu heikel. Ihre drei Töchter waren auch „nicht begeistert von der Vorstellung, dass ihre Mutter während sie unter Anderem fürs Abi pauken, sie allein lässt, um sich in Kabul herumzutreiben“, so Tanja Langer. Also musste David ihr seine Umgebung sehr genau beschreiben.
Galal und ich sprechen nun mit Elisabeth Arend über unsere gemeinsame Arbeit an seinen wunderbaren Gedichten: wie wir uns im Berliner „Haus für Poesie“ im Rahmen eines Versschmuggel-Projekts kennengelernt haben, weil der schon vor zwanzig Jahren von Damaskus nach Deutschland ausgewanderte Schriftsteller Douraid Rahhal das Gefühl hatte, wir hätten ähnliche Themen, einen bisweilen verwandten Stil und könnten uns gut verstehen. Recht hat er gehabt! Wir sprechen über das Übersetzen, wenn beide Beteiligte die Sprache des Anderen nicht beherrschen und auf Dolmetscher angewiesen sind. Wie funktioniert dieses Arbeiten mit einer sprachlichen Lücke, einer menschlichen Brücke? Wir erzählen von den Rohübersetzungen, die als Grundlage für meine Nachdichtungen von Galals Gedichten gelten und wie wir uns mit Hilfe von Dolmetschern zum Teil Wort für Wort voranarbeiten. Dabei kommen Fragen auf wie: „Bei dir heißt es, der Scharfschütze würde nach getaner Arbeit zuhause ‚kopulieren’. Hast du diesen Begriff aus der Tierwelt absichtlich verwendet? Oder hat der Übersetzer hier nur eine von vielen Möglichkeiten gewählt und dir ging es nicht so sehr um die animalische Konnotation?“ Oder: „Bei dir tauchen in diesem Gedichte mehrfach Fische auf – immer in bedeutungsvollem Zusammenhang. Im Christentum steht der Fisch als Symbol sowohl für Christus als auch für das Leben an sich. Hat der Fisch im Islam auch eine besondere Bedeutung?“ Sprachen sind nie deckungsgleich – sie überschneiden sich in ihrem Wortschatz in einigen Bereichen, in anderen unterscheiden sie sich stark voneinander. So erfahre ich, dass es im Arabischen an die sieben verschiedene Worte für Himmel gibt, und mehrere Worte für „hinaufsteigen“, je nachdem in welchem Kontext das Wort vorkommt: Hinaufsteigen im spirituellen Sinne, physisch, auf der Karriereleiter…
Wir lesen zwei Gedichte von Galal „Weniger Hass“ und „Zuhause“. Obwohl der Workshop schon seit sechs Stunden andauert, ist es absolut still im Raum, man spürt förmlich wie gebannt die Zuhörer lauschen. Im Anschluss an den Vortrag folgen einige Fragen aus dem Publikum. Zum Beispiel danach, ob wir uns denn nicht auch mal über eine Wortwahl streiten würden – ob das denn so einfach sei. Wir sehen uns an und zucken die Schultern. Streiten? Galal sagt, er würde mir eben „vertrauen“, und ich sage, dass ich mich bemühe, sehr genau zu eruieren, was Galal meint, um dann seinem poetischen Rhythmus im Deutschen ebenfalls Klang und Takt zu verleihen. Wieder wird gefragt, ob wir bei diesem schwierigen sprachlichen und kulturellen Verständigungsprozess nicht auch in Uneinigkeit geraten, streiten würden. Zwei Schriftsteller, der eine dichtet, der andere setzt seinen Namen unter die Nachdichtung – ? Doch wir schütteln den Kopf. „Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass wir bei diesem zugegebenermaßen störanfälligen Prozess einfach nicht aneinandergeraten“, gebe ich zu. Wir konnten uns bisher einfach immer gut einigen. Auch unsere Übersetzer und Dolmetscher haben bisher keine Eitelkeit an den Tag gelegt, waren ausgesprochen umgänglich.
Das Publikum lauscht, ob es nicht doch noch eine Erklärung für die unter Autoren wohl sehr seltene Friedfertigkeit geben könnte. Schließlich antworte ich psychologisch: „Wir sind beide keine Alphatiere. Die Wahrheit liegt im Kompromiss“. Das Publikum lacht. Man hat verstanden. Es geht uns wirklich um die Texte, nicht um Rechthaberei. Und: Sprache kann sowieso immer nur eine Annäherung an das Unsagbare, von dem die Poesie spricht, sein.
Aber deine Seele bleibt ein Wolf, der jede Nacht heult
Annett Gröschner und Widad Nabi gehen in ihren Texten den Spuren nach, die der Krieg in den Städten und in den Menschen hinterlässt – damals in Berlin und heute in Aleppo. Bei Meet your neighbours in der Amerika-Gedenk-Bibliothek gaben die beiden Autorinnen am 3. Dezember erstmals Einblick in den Beginn ihrer eindrucksvollen literarischen Korrespondenz auf zwei Sprachen.

Nach einer einleitenden Begrüßung und Vorstellung der Autorinnen durch die Moderatorin Ines Kappert ergriff die kurdisch-syrische Lyrikerin Widad Nabi selbst das Wort und wendete sich an die Menschen, die sich am Sonntagnachmittag im Salon der Amerika-Gedenk-Bibliothek eingefunden hatten, um ihrem literarischen Austausch mit Annett Gröschner, ihrer Tandem-Partnerin aus dem Projekt Weiter Schreiben, zu lauschen. Bei Weiter Schreiben gehe es darum, Netzwerke zu öffnen und über Literatur Nähe aufzubauen. Welcher Ort könnte sich dafür besser eigenen als eine öffentliche Bibliothek, in der die unterschiedlichsten Leute der Literatur wegen aufeinandertreffen? Während Widad und ihr Gedicht „Hätte ich ein Gartenherz“ erst auf Arabisch vortrug und Annett es anschließend in der deutschen Übersetzung von Suleman Taufiq las, füllte sich der Raum mit immer mehr Menschen, die zufällig auf dem Weg zu dem kleinen Café vor dem Salon auf die lesenden Stimmen aufmerksam geworden waren.
„Hätte ich ein Gartenherz,
die Bäume würde ich nach dir benennen,
das Gras wachsen lassen
bis an dein Haus.
Die weißen Blumen
beleuchteten die dunkle Strecke
zwischen meinem und deinem Herzen.
Hätte ich ein Gartenherz,
eine purpurrote Malve würde ich
unter den Stiefeln des Soldaten wachsen lassen,
der auf das Herz eines Kindes zielt.
Ich würde ihn auffordern zu schauen,
was auf dem Boden wächst.
Vielleicht beugte er sich dann herab,
um die Schönheit unter seinen Füßen zu sehen,
und vielleicht vergäße er seinen Schuss.“
Hätte ich – so würde ich – vielleicht…, ein Gedicht im Konjunktiv. Wie machtlos musste das einzelne Ich sich im Krieg fühlen? Die Erfahrungen, die Widad in ihrer Heimat Aleppo machen musste, erinnerten ihre deutsche Kollegin Annett an den Verlust und die Zerstörung, die den Menschen in Berlin während des Zweiten Weltkriegs wiederfahren war.
Als Ines Kappert sie nach der Bedeutung jener Kriegsschicksale in ihren Texten fragte, antwortete die Berliner Autorin, sie erlebe seit frühester Kindheit im Traum die Verschüttung ihrer Mutter, als sei sie selbst diejenige, die damals unter Trümmern im Keller begraben lag. Das Trauma sei ihr Erbe. Und nicht nur in ihr, auch an den Häusern und in den Straßen der Stadt könne sie die Spuren des Krieges noch heute lesen: „In Berlin laufen wir alle über die schlafenden Zünder von Bomben.“ Der Krieg, so kommentierte sie dies Zitat, sei nie abwesend – sei es der, den eine frühere Generation in Berlin erlebte oder jener, der Widad Nabi nach Berlin geführt hatte.
Diese glitt erneut in einen rhythmischen Lesefluss auf Arabisch. Und während wir das Gedicht „Der Ort von Erinnerung beleuchtet“ im Original hörten, griff die rechte Hand der Lyrikerin mit einer raschen Bewegung in die Luft, öffnete und schloss sich dann ebenso schnell wieder.
„Die Entfernung ist
eine Zwangsgeografie,
trennt zwei Städte voneinander.
Zwischen ihnen Tausende von Meilen,
in einer hast du deine Kleider auf der Wäscheleine gelassen,
in der zweiten streckst du deine Hand in die Luft,
um deine Kleider von der Terrasse in der ersten zu nehmen.“
Vor meinem Auge entstand das Bild einer Person zwischen den Orten: In der Realität war sie meilenweit von ihrem Ursprung entfernt, in der Erinnerung war dieser zum Greifen nah.
Welche Nähe entstehen kann, wenn man die Literatur nicht nur als Raum der Erinnerung, sondern als Raum des Dialogs über die Erinnerung begreift, zeigte das Ergebnis der gemeinsamen Korrespondenz zwischen den zwei Autorinnen, von der sie im Anschluss an die Lesung ihrer Gedichte berichteten. Obgleich sie bislang völlig unterschiedliche Lebenswege gegangen waren, so Annett, habe sie auf Anhieb eine intensive Bindung zu Widad empfunden – noch bevor sie diese zum ersten Mal traf.
Hätte ihr jemand einen Packen Gedichte gegeben mit der Bitte, eines daraus auszusuchen und „Der Ort von Erinnerung beleuchtet“ wäre dabei gewesen, so hätte sie dieses unter Hunderten ausgewählt. „Traurig ist, dass du die Ruinen deines Hauses im Traum besuchst und zurückkehrst ohne Staubspuren an deinen Händen.“ Als Annett dies las, musste sie an ein Gedicht denken, welches sie selbst vor 25 Jahren geschrieben hatte und das über Zeit und Geografie hinaus mit dem von Widad korrespondiere, da beide den Gedanken teilen, dass Häuser ein Gedächtnis besitzen.
„ich trug die möbel die treppe hinauf
ich fing die gläsernen spatzen und tauben
aus dem keller trug ich die toten
in ihre wohnung zurück frau loeffler
zog ein kleid an aus luft
in der mode der dreißiger.“
In „Das verschwundene Haus“ imaginiert Annett Gröschner den Wiederaufbau eines Hauses, in dem Möbel verrückt, Kalender abgerissen und Uhren zurückgedreht werden, um die Toten aus den Trümmern im Keller zurück in ihre Wohnungen zu tragen. Frau Löffler, ergänzte die Autorin, hatte es wirklich gegeben, ihr Name stand 1943 im Berliner Adressbuch unter der Adresse Prenzlauer Berg, Rykestraße 27.
Als Reaktion auf die literarische Verbindung zwischen ihr und Widad konzipierte sie wiederum einen neuen Text, der ihre beiden Gedichte sowie ihre erste Begegnung miteinander verwebte:
„Das Leben wird nicht so schlimm, / es schenkt dir ein neues Haus. / Aber deine Seele bleibt ein Wolf, / der jede Nacht heult / auf der Stufe deines alten Hauses, sagt Widad.
Das einzige, was an dem Ort meines Gedichtes unverändert blieb, sind die Steine, mit denen die Gehwege gepflastert sind. Ich ging mit Widad diese Wege meiner Recherchen und plötzlich blieb sie stehen, zeigte auf die Pflastersteine und sagte: „Sie erinnern mich an Aleppo. Dort gibt es auch diese gepflasterten Wege (…).“
Nachdem Annett ihren Text mit dem Titel „Unter Hunderten“ vorgetragen und die Begegnung mit Widad aus ihrer Perspektive geschildert hatte, hielt sie inne und wartete, dass ihre Schreibpartnerin die Worte in der Übersetzung durch ihre Sitznachbarin Leila Chammaa erreichten. Auch Widad konnte sich noch gut an das erste Treffen am Schauplatz des verschwundenen Hauses erinnern, kam es in der Übersetzung aus dem Arabischen zurück. Doch während Annett jenen Innenhof, in dem sie damals gemeinsam standen, mit der Recherche zu ihrem Gedicht und dem Gedanken an die Verschüttung ihrer Mutter verband, kamen in Widads Erinnerung beim Anblick des Pflastersteins nicht nur die Bilder von Aleppo zum Vorschein.
Wie wir infolge ihrer literarischen Antwort auf Annetts „Unter Hunderten“ erfuhren, hatte genau dieses Haus in Berlin bereits die Spuren ihrer Schritte gespeichert. In ihm hatte Widads Freund gelebt und sie selbst hatte aus einem der Fenster in den Hof hinabgeschaut. Nun, so erklärte sie, als sie mit ihrer Freundin Annett an diesen Ort zurückkehrte, wurde sie zur fremden Besucherin, die den Blick nach oben zum Fenster richtete. Die Zeit verändert den Standpunkt, von dem aus wir die Dinge betrachten.
Gebannt lauschte ich den Frauen, die vor mir am Tisch saßen und sich gemeinsam auf zwei Sprachen über Erfahrungen aus unterschiedlichen Zeit-und Raumkontexten unterhielten und dabei dennoch nachempfanden, was die jeweils andere fühlte. Wie es sich anfühlte, wenn Orte einen im Stich ließen und, ob der geographischen Distanz, in der Erinnerung wiedereinholten.
Als Ines Kappert den Blick abschließend über die Menschen im Publikum schweifen ließ und sich nach Rückfragen erkundigte, meldete sich eine Frau, die während des Gesprächs der Autorinnen aus dem großen Seitenfenster der Bibliothek geschaut hatte. Draußen war es inzwischen dunkel geworden, sodass ich kaum etwas erkennen konnte, als sie durch die Scheibe hindurch auf den Parkplatz deutete. Es sei mehr eine Beobachtung, die sie teilen wollte: Während sie den Frauen zugehört hatte, sei ihr draußen eine Person aufgefallen, die ein Wohnmobil mit der Aufschrift „Lux“ geparkt hatte. Und so endete die Veranstaltung mit dem Bild eines „mobilen Hauses“, in dem wir unsere Erinnerungen zu jeder Zeit, an jeden Ort mitnehmen können.
„Die Dunkelheit gedeiht
in den verlassenen Häusern
wie das Kraut im April.
Trotzdem ist der Ort von Erinnerung beleuchtet.“
(Widad Nabi)
Der Wert einer anderen Perspektive
Am 22. März fand in der Münchner Stadtbibliothek Hadern im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus wieder ein Abend der Münchner Reihe „Meet your neighbours“ statt. Die Münchner Autorin Lena Gorelik sprach mit der aus Uganda stammenden Journalistin und Kolumnistin Lillian Ikulumet über ihre Sicht auf München und das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in einem fremden Land.

Trotz Schneeregenwinterniesel fanden an diesem Donnerstagabend viele Interessierte den Weg in die Stadtbibliothek Hadern. Nach der Begrüßung durch den Leiter der Stadtbibliothek Josef Niedermeier gab Lena Gorelik direkt den Ton des Abends vor: Sie fühle sich angesichts der Sitzordnung des Publikums an eine Klassenfahrt im Bus erinnert, bei der sich immer alle auf den hinteren Plätze drängen und niemand vorne sitzen will – und siehe da, der Aufruf wirkte, das Publikum kam näher. Und genau in diesem Sinn sollte es weitergehen, denn mit zum schönsten Teil der Veranstaltung gehörte – das sei gleich vorneweg gesagt –, dass es tatsächlich gelang, die Trennlinie zwischen Publikum und Bühne zu durchbrechen und in einen großen gemeinsamen Dialog einzusteigen.
Lilian Ikulumet ist 37 Jahre alt und vor sechs Jahren aus Uganda ausgewandert, wo sie seit 2001 professionell für überregionale Zeitungen schrieb. Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss für Journalismus und Kreatives Schreiben an der Namasagali University in Uganda und einen Master für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule Macromedia in München. Zurzeit arbeitet sie als freie Journalistin in den Bereichen Kultur, Menschenrechte, Migration, Lebensstil und Mode bei der Zeitung NeuLand in München, außerdem hat sie eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung unter der Rubrik „Neue Heimat“.
Lilian Ikulumets erster Text drehte sich um interkulturelle Beziehungen aus der Perspektive einer Uganderin. So schreibt sie, dass ihre erste Beziehung mit einem deutschen Mann ein Kulturschock für beide Seiten gewesen sei. Angefangen mit einer vollkommen unterschiedlichen Perspektive auf das Leben: Sie selbst freue sich über Kleinigkeiten und lebe nach der Devise „Whatever can go wrong, will surely do“, ihr Freund dagegen wollte dem Schicksal nicht so freie Hand überlassen. Ein weiteres großes Problem sei das Zeitmanagement, frei nach der Devise „Europäer haben Uhren, Afrikaner haben Zeit“, so Ikulumet. Dass Zeit für sie keine große Rolle spiele und eine Stunde später als zur verabredeten Zeit aufzutauchen alles andere als ungewöhnlich sei, wurde in ihrer Beziehung zu einem „Megaproblem“ – er wollte gerne planen, und sie fand ihn verspannt.
Auch Liebe und Zuneigung werden, laut Lilian Ikulumet, in Uganda anders ausgedrückt. Zur Begrüßung etwa genüge ein Handschlag, geküsst werde eher zuhause, was für viel Unsicherheit sorgte. Und auch vor der Küche machen die Unterschiede nicht halt. Da in Uganda viele verschiedene Gerichte zu einer Mahlzeit serviert werden, wirkt die bayerische Küche für Lilian Ikulumet eher wie ein Fastentag. Hingegen ist es in ihrer alten Heimat durchaus normal, Knochen zu kauen und auszuspucken – was hierzulande, wie sie feststellen musste, gar nicht gern gesehen wird.
Einzig die Probleme mit dem Rollenbild kannte sie auch aus Afrika, wo sich Westafrika vom Osten deutlich darin unterscheidet, wer für die Familienversorgung aufkommt, und ob der Ehemann auch die Familie der Frau unterstützen muss. In Afrika, so Ikulumet, passt sich meistens die Frau der Kultur des Mannes an, in Deutschland streben Frauen nach Gleichberechtigung – auch das Ankommen in einer interkulturellen Beziehung ist also harte Arbeit.
Nach der Lesung fragte Lena Gorelik, woran sich Lilian nie gewöhnen würde. Spontan fiel der 37jährigen der Diätwahn der deutschen Frauen ein. Ihrer Ansicht nach herrsche in Deutschland ein großer Widerspruch: Es gebe so viel zu essen, und trotzdem hielten fast alle Diät und essen nur Kleinigkeiten. Der zweite große Unterschied sei die öffentliche Zurschaustellung privater Gefühle – noch immer küsse sie ihren Partner ungern in der Öffentlichkeit.
Als nächstes wollte Lena Gorelik wissen, wie sie mit der typischen deutschen Frage „Wie geht es dir?“ umgehe. In Deutschland frage man das oft und bekomme in der Regel „gut!“ zu hören. Das, so Lilian Ikulumet, würde in Uganda nicht passieren, denn dort gehe man sofort ins Detail und beantworte die Frage umfassend. Dort sei es keinesfalls nur eine Floskel.
Angesichts des Wetters lag die Frage nahe, wie Lilian Ikulumet mit dem deutschen Winter zurechtkomme. Da Schnee in Uganda immer nur als Watte auf den Weihnachtsbaum geklebt werde, war sie in ihrem ersten Winter noch fasziniert davon, ein Reiz, der sich leider schnell verlor. Jetzt empfinde sie ihn nur noch als schrecklich kalt. Diese Kälte ist aus ihrer Sicht auch für das gemeinschaftliche Zusammenleben nicht besonders zuträglich. So sei es in Uganda ganz normal, regen Kontakt mit seinen Nachbarn zu halten, sie gehörten schon fast zur Familie. In Deutschland habe sie versucht, ihre Nachbarn kennenzulernen, aber die meisten wollten davon nichts wissen. In Uganda gelte die Regel: Wenn jemand laut Musik macht, gibt es auch Essen, also kommen alle zusammen. In Deutschland heiße es eher: Wenn jemand laut Musik macht, kommt die Polizei.
In der Stadtbibliothek Hadern ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Das Thema Nachbarschaft – Meet your neighbours – baute die Brücke zum Publikum und mit vielen Wortmeldungen wurde darüber diskutiert, wie sich Nachbarschaft in Deutschland ändern könnte. Gemeinsam wurde überlegt, woran es liegt, dass sich hier viele in ihre eigenen vier Wände verkriechen und wenig Interesse an dem zeigen, was im eigenen Haus oder Viertel vorgeht. Viele Aspekte wurden von allen Seiten genannt – das deutsche Wetter begünstigt einen Großteil des Jahres über ja nicht gerade, dass man sich draußen aufhält, wo es am einfachsten wäre, sich zu treffen. Außerdem herrsche ein Unterschied zwischen Stadt und Land bzw. zwischen Wohnhäusern, bei denen ein Treffpunkt oder Hinterhof fehlt, und architektonisch offen gebauten Siedlungen. In Afrika spielt in diesem Zusammenhang die Kirche eine große Rolle, so wie das vor einiger Zeit in Deutschland noch der Fall war, wo die Kirche auch ein Treffpunkt war und mehr Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft schuf. Heute muss man sich dafür oft neue Orte und neue Organisationen suchen, und vielleicht können wir mit unseren „Meet your Neighbours“-Veranstaltungen dazu einen kleinen Beitrag leisten. An diesem Abend jedenfalls hat es wunderbar funktioniert.
Gute Musik, Crossover und temporäre Nachbarn im Betonparadies
Ein improvisiertes Musikprojekt in einem temporären Kulturraum, Crossover-Klänge und die Frage nach grenzüberschreitender nationalistischer Segregation, dazu Nachbarn aus dem Westend und einige Kulturschaffende aus ganz München – zusammengebracht von Denijen Pauljević. Das war die zweite Münchner Meet your neighbours-Veranstaltung im März.
Text:
Foto: Lisa Hörterer

Nach den letzten beiden Veranstaltungen in der Monacensia und in der Stadtteilbibliothek Hadern hatte sich Denijen Pauljević für den nächsten Meet your neighbours-Abend einen ganz besonderen Ort ausgesucht: das Köşk. Die Bezeichnung – im Deutschen erinnert das Wort „Kiosk“ daran – stammt aus dem Türkischen, Köşk heißt Villa. Für 1000 Tage Zwischennutzung bietet die ehemalige Stadtteilbibliothek im Münchner Westend, dem Viertel jenseits von Oktoberfest und Schwanthalerhöhe, einen Kulturfreiraum. Er wird von Jugendlichen bespielt, hier treffen sich Nachbarschaftsinitiativen zum Chorsingen, vertonen Menschen ihr Viertels oder organisieren Ausstellungen – wie zur Zeit der Veranstaltung ein Fotoprojekt mit Kindern aus Uganda. Eine Villa ist das Köşk allerdings nicht. Es ist ein Flachbau, eingerahmt von Grün und Spielplatz. Im Innenraum mit den deckenhohen Fenstern und dem Betonboden gibt es außer nackten Heizkörpern, einer improvisierten Garderobe und einer kleinen Bar keine weitere Einrichtung.
In diesen Rahmen hatte Denijen Pauljević den seit 2008 in München lebenden Kulturschaffenden Asmir Šabić (alias Chaspa) geladen. Der brachte den Musiker Menya Arnold und das gemeinsame Projekt „Die Arbeiterklasse schreitet ins Paradies“ mit. Thema des Abends sollte „politische und musikalische Dissidenz unter dem Vorzeichen der Migration“ sein. Der Name des Bandprojekts ist an einen italienischen Film aus dem Jahr 1971 angelehnt, in dem der Produktionsarbeiter Lulù Massa sich erst gegen den Kampf seiner Kollegen für mehr Rechte der Arbeiter stellt und stattdessen an der Perfektionierung seiner Effizienz arbeitet, um dann – nach dem Verlust eines Fingers wegen Müdigkeit, weil er unermüdlich weiter geschuftet hatte – am Ende als einziger weiter zu kämpfen, dem Wahnsinn nah. Mehr Informationen gab es zu Anfang nicht – außer dem Hinweis, dass die beiden erst seit ein paar Monaten an ihrer Idee experimentieren, dass es der erste öffentlichen Auftritt des Projekts sei und dass das Publikum „auch Fehler genießen“ solle.
Dum-dum, dum-dum-dum … der erste Track aus dem digitalen Mixer setzte mit tiefen Bässen ein, dazu eine Stimme, die von „democratize me“ erzählte, und von Tagen harter Arbeit. Das Publikum war augenblicklich dabei. Chaspa nahm die treibenden Beats auf, spielte seine Bouzouki darüber – ein Lauteninstrument, das vor allem aus dem griechischen Raum bekannt ist. Der Sound seiner Bouzouki changierte zwischen genau jenen Klängen, die man gemeinhin mit Balkanmusik verbind
et und einem E-Gitarren-ähnlichen Klang. Nach dem Solo gab er der Trompete von Menya Raum, legte das eben live Eingespielte als neue Tonspur über die Beats. Die fünf Tracks hatten alle eine eigenständige Wirkung, versetzten die Zuhörer*innen, manche mit geschlossenen Augen, teils in eine Art Trance, um sie mit harten Elektroklängen wieder herauszureißen und in Bewegung zu versetzen. Nicht immer klappte alles. Dass die digitale Technikzwischendurch einen Neustart erforderte und die einzelnen Tracks mehrfaches Umstöpseln störte das Publikum wenig, verlieh der ganzen Performance aber den Eindruck echter Handarbeit. Und obwohl viele Elemente bereits vorher eingespielt waren, machte genau das diese Inszenierung einmalig und unwiederholbar.
Die Zuhörer*innen mögen sich an Westernklänge, ungarische Volksweisen, Dance-House, Urlaub und Meeresrauschen oder afrikanische Drums erinnert gefühlt haben, dabei manch Neues, nicht Einzuordnendes gehört haben – Crossover über die einzelnen Stücke, innerhalb der verschiedenen Frequenzen eines Stücks und irgendwie auch in einem einzigen Augenblick, zwischen verschiedenen Tönen. Die beiden Musiker selbst sagen über ihr Projekt, dass es „Geschichten von bewaldeten Bergketten und wilden Flüssen erzählt. Und dass ihre Melodien, Beats und Gedanken eine Ästhetik erzeugen sollen, die von Arbeit, der Fremde, der Heimat und von dem Dazwischen berichten will. Es ist Musik, die uns hält, die uns die Vielfalt der Welt zeigt. Erschaffen, um uns zu fangen, um unsere Seelen zu retten.“ Dargestellt wurde die Musik durch den sich ständig in Bewegung befindlichen Chaspa, der Tonspur über Tonspur legte (und zwischendurch sogar meinte, er habe zu kämpfen) und den beinah stoisch ruhigen Menya, der mit seiner Trompete Reinheit und Klarheit verkörperte.
So verschieden das Temperament der beiden Musiker auf der Bühne war – so verschieden war auch die Botschaft, die sie mit dem Projekt verbinden. „Ich habe Angst“, war eine der ersten Aussagen von Chaspa. Er lebe gerne in München, verfolge aber die Entwicklungen in seinem Heimatland Bosnien mit großer Sorge. Er beobachte eine weiter fortschreitende nationalistische Segregation, die mit dem Ende des Krieges keineswegs abrupt zu Ende gewesen sei. Und er wundere sich, dass international kaum Sorge über das faktische Einparteiensystem in Serbien geäußert werde. Mit „Die Arbeiterklasse schreitet ins Paradies“ wolle er darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Menschen aus den ehemals jugoslawischen Staaten auf der Suche nach Arbeit diese Länder verlassen. Und dass diese Menschen nationalistisch geprägt aufgewachsen seien, dass auch die internationale Tendenz zu mehr politischen Populismus in jenen Ländern auf besonders fruchtbaren Boden falle. Er wünsche sich ein stärkeres Europa und dass die Menschen in den Nachbarländern des Balkans, wozu er Deutschland rechnet, genauer hinsehen und sich bewusst werden, dass Nationalismus vor Grenzen keinen Halt mache, sondern auch exportiert werden könne. Er fügt hinzu: „Ich habe erlebt, wie schnell bloße Rhetorik in Gewalt umschlagen kann.“ Der aus Ungarn stammende Musiker Menya meinte im anschließenden Gespräch mit Denijen Pauljević, dass er nicht nur von Europa sprechen wolle, sondern ihm daran liege, einen allgemeinen, weltumspannenden Humanismus zu leben. Volksmusik sei eine seiner Ausdrucksformen, weil sie aus dem Volk stamme und gegen nationalistische Tendenzen verteidigt werden müsse. Nur wenige Minuten dauerte das Gespräch zwischen Chaspa und Denijen, schon kamen die ersten Wortmeldungen aus dem Publikum. Einige, die dem Konzert von weiter hinten im Raum gelauscht hatten, rückten mit nach vorne, es kam zu einem regen Austausch mit den Künstlern und innerhalb des Publikums. Uneinigkeit herrschte unter anderem darüber, ob „man“ sich „in Deutschland“ tatsächlich zu wenig Gedanken über den Balkan mache. Oder darüber, ob es die EU den Kulturschaffenden tatsächlich schwer mache, gemeinsame Projekte umzusetzen. Eine andere Diskussion drehte sich um die Feststellung, dass Künstler mit migrantischem Hintergrund zwar oft sehr leicht Anschluss finden, aber immer wieder im Rahmen eines bestimmten Stereotyps gebucht werden. In Chaspas Fall heißt das, dass er sich, als Nirvana-Fan aus Bosnien, die Bouzouki erst in Deutschland für diverse Balkanprojekte aneignete.
Das Meet your neighbours-Konzept wurde an diesem Abend insofern perfekt umgesetzt, als die Menschen auf der Bühne sofort mit den Menschen auf den Ledersofas davor ins Gespräch kamen. Freilich waren auf beiden Seiten keine oder nur sehr wenige Neuankömmlinge vertreten (denn Chaspa und Menya kann man längst zu alteingesessenen Künstlern rechnen) – aber dafür Menschen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlichster Herkunft, die neben einem bewegenden musikalischen Auftritt ganz sicher die Anregung mitnahmen, sich mit den Balkanstaaten mal wieder jenseits ihres Strandurlaub zu befassen. Und wenn Chaspas These, dass verschiedene Kultur-Projekte in München viel zu wenig miteinander kommunizieren, stimmt, dann hat dieser Abend darüber hinaus das Köşk und die Glockenbachwerkstatt (Chaspas musikalische Heimat), Westend und Glockenbachviertel zusammengebracht und den Blick einmal mehr auf die Mehrheitsgesellschaft und ihren Umgang mit dem Fremden zurückgelenkt.






Zena Awad im Museum Fünf Kontinente
Am 12. April hielt die syrische Archäologin Zena Awad im Rahmen der Meet your neighbours-Begegnungsreihe einen Vortrag über die Zerstörung antiker Stätten und Bauten in Syrien. Im anschließenden Gespräch mit Silke Kleemann ging es auch um die Frage was diese Zerstörung für die syrische Bevölkerung bedeutet.
Text: Katja Huber
Foto: Nanni Schiffl-Deiler

Es ist Tag fünf nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Duma.
Es ist der Vorabend der Luftangriffe von den USA, Frankreich und Großbritannien auf Ziele in Syrien.
Es ist zwei Jahre, nachdem die Staatsanwaltschaft Genf im Zollfreilager zufällig auf syrisches Raubgut stieß: Die Terrororganisation IS hatte aus Grabungsstätten in Palmyra wertvolle Reliefs und Tonbüsten aus dem 2. Jh. n. Chr. geplündert und wollte diese von Genf aus illegal auf dem europäischen Antikmarkt verkaufen.
Es ist das Jahr sieben seit Beginn dessen, was Zena Awad an diesem Abend, er findet in englischer Sprache statt, meist mit „the crisis“ benennt.
Als die syrische Archäologin Zena Awad, ihr Freund und Kollege Raaed Alkour und die Moderatorin Silke Kleemann am 12. April 2018 im Münchner Museum Fünf Kontinente zusammen kommen, um Zenas Arbeit und eines ihrer geplanten Projekte vorzustellen und vor allem über den Zustand historischer Bauwerke und archäologischer Stätten im heutigen Syrien zu sprechen, rücken sie dem Publikum vor allem eins ganz deutlich ins Bewusstsein:
Die Bewohner*innen Syriens haben seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 sehr viel, sehr unmittelbar verloren: Angehörige, Freunde, Wohnmöglichkeiten, Arbeit. Mit der Zerstörung der historischen Stätten verlieren sie auch einen Teil ihres kulturellen Erbes und damit auch ein Stück ihrer Identität.
Ein kulturelles Erbe, das weit zurückreicht, wie Zena im Laufe des Abends noch anhand einiger Dokumente zeigen wird, zum Beispiel der Fotografie des weltweit ältesten Friedensvertrags, der im Jahr 1258 im syrischen Kadesch in Keilschrift verfasst und zwischen dem ägyptischen Pharao Ramses II. und dem Hethiterkönig Hattušili geschlossen wurde.

Der Abend beginnt mit einer ebenso eindrucksvollen wie erschütternden Powerpointpräsentation. Die Methode der Vorher-Nachher-Fotografie ist vielen vor allem aus der Werbung, von Internet-Bannern oder Spam-Mails vertraut, die dokumentieren, wie hässliche Entchen in nur sieben Tagen/Wochen/Monaten zu stolzen Schwänen werden, von Misanthrop*innen mit Übergewicht zu strahlenden Menschenfreund*innen mit idealem Body-Mass-Index. Abgesehen davon, dass diese Bilder oft einen Wandel dokumentieren, dessen Ideale höchst fragwürdig sind, kann man in vielen Fällen davon ausgehen, dass sie bearbeitet, manipuliert, gefakt sind.
Die Bilder, die Zena im Museum Fünf Kontinente zeigt, sind echt. Sie stammen von syrischen Ausgrabungsteams, von Zenas Archäologen-Freunden oder aus Privatsammlungen. Diese Fotos dokumentieren einen umgekehrten und noch viel radikaleren Wandel: Vom Intakten, vom über Jahrhunderte Gewachsenen, Geprägten und Entwickelten, vom über Jahrtausende Erhaltenen zum über Nacht Zerstörten. Jahrhunderte lang bereisten Wissenschaftler und Touristen Syrien, um historische Stätten zu besuchen, die das Wirken verschiedener Epochen, Kulturen und Religionen dokumentieren.
Die fast 2000 Jahre alte syrisch orthodoxe Umm az-Zinnār-Kirche in Homs (Sankt-Marien-Kirche des Heiligen Gürtels) enthält eine Reliquie, die als Marias Gürtel angesehen wird. Dieser Gürtel ist das Äquivalent der syrischen Kirche zum katholischen Gürtel des Thomas in der Prato-Kathedrale in Italien. Die Reliquien beziehen sich auf die gleiche Legende über die Jungfrau Maria, die dem Apostel Thomas ihren Gürtel als Beweis für ihre Aufnahme in den Himmel übergeben haben soll. Im Jahr 2012, im zweiten Jahr des Bürgerkriegs, wurde die Kirche von den bewaffneten Oppositionsgruppen gegen die Baath-Regierung Baschar al-Assads als Schild zweckentfremdet und im Kampf mit den Streitkräften stark beschädigt. Spätere Zusammenstöße führten zu weiteren Zerstörungen. Die Fotos, die Zena an diesem Abend präsentiert, zeigen schwerste Schäden im Dachgebälk und an der Fassade sowie einen zerstörten Kirchturm.
Die Umayyaden-Moschee von Aleppo, im Jahr 715 als zweite Moschee der Stadt errichtet, wurde im Jahr 2013, im dritten Jahr des Bürgerkriegs, so schwer beschädigt, dass das Minarett der Moschee einstürzte. Regierung und Rebellen bezichtigen sich gegenseitig der Verantwortung für die Zerstörung. Die von Römern, Griechen und Persern geprägte antike Oasenstadt Palmyra in der syrischen Wüste galt als einzigartige Kulturstätte. Dann zerstörte der sogenannte Islamische Staat Ende August 2015, im fünften Jahr des Bürgerkriegs, den Baal-Tempel. Das römische Theater aus dem 2. Jahrhundert nach Christus wurde im Januar 2017 schwer beschädigt.
Zu den jüngsten Bildern der Zerstörung, die Zena an diesem Abend präsentiert, gehört der Tempel von Ain Dara, der im siebten Jahr nach Beginn des Bürgerkriegs, im Januar 2018 von der türkischen Luftwaffe zu 60 Prozent zerstört wurde. „Dreitausend Jahre Geschichte pulverisiert“ lautete eine Schlagzeile Anfang Februar. Bei Zenas zügig und im wissenschaftlich-sachlichen Ton gehaltenen Vortrag beschleicht einen die Frage, um wieviele Beispiele ihre Präsentation wohl noch erweitert werden wird, wie viel Geschichte und Erbe wohl noch pulverisiert werden wird, in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren.
Doch dann beendet Zena ihre Präsentation und stellt das Projekt vor, für das sie und ihr Partner, der syrische Archäologe Raaed Alkour noch Unterstützung suchen. Ein Projekt, mit dem die beiden auf all die Zerstörungen reagieren wollen. Schon bei dieser Vorstellung und im anschließenden Gespräch mit Silke Kleemann weicht der sachliche Ton einem leidenschaftlichen und allen vorangegangenen Schilderungen zum Trotz strahlt Zena während des restlichen Abends einen ungebrochenen Optimismus aus.

Das Projekt ist eine Ausstellung mit einer großen Anzahl von Vorher-Nachher-Fotos, erweitert durch Vorlesungen und Präsentationen, Dokumentarfilme sowie einige 3 D-Modellrekonstruktionen zerstörter Stätten. Dieses Projekt, das fasst Zena zusammen und Raaed wiederholt es noch einmal, soll die Bedeutung des syrischen Erbes herausstellen. Es soll den Zustand der beschädigten Stätten dokumentieren und besonders auch auf den Schmuggel von und den illegalen Handel mit syrischen antiken Gegenständen hinweisen, der, wie auch all die Zerstörung, zu einem Verlust des syrischen Erbes führen wird. Es soll Deutschen, die keine Gelegenheit hatten, Syrien vor dem Bürgerkrieg kennen zu lernen, die Geschichte von Syrien näherbringen und Syrer, besonders diejenigen, die während des Bürgerkriegs geboren und aufgewachsen sind, an die Bedeutung ihrer Zivilisation erinnern.
Als Silke Kleemann anlässlich der gezeigten Bilder, aber wohl auch anlässlich der Größe des Vorhabens, vielleicht auch anlässlich der Tatsache, dass Zena gerade dabei ist, Deutsch zu lernen und mitten in der Arbeit an ihrer Dissertation steckt (für die sie nach eigenen Angaben schon an die 2000 Seiten deutschsprachige Fachliteratur gelesen und ins Englische übersetzt hat) – als Silke Kleemann die Frage stellt, woher Zena all ihre Stärke nehme und ihren Optimismus, antwortet sie: „Das ist unser Blut, wir sind Syrer.“ Außerdem verweist sie auf all die Syrer, die sich im Jahr sieben des Bürgerkriegs befinden und noch immer stark sind. Zena ist Syrerin, sie ist vielleicht aber auch eine Ausnahmeperson mit einer Ausnahmebiographie und sicherlich eine bemerkenswerte Frau in einer bemerkenswerten Situation.
Da der Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit eine vorderasiatische Göttin ist, wären ihr idealer Forschungsort syrische Museen und Kunstsammlungen, doch das würde bedeuten, sich mitten ins Bürgerkriegsgeschehen zu begeben. Als DAAD-Doktorandin ist Zena zwar mit einem Studentenvisum in Deutschland, das bedeutet aber nicht, dass sie auch automatisch Visa für alle anderen europäische Länder hat. Auch Recherchen in bedeutenden anderen Museen, wie zum Beispiel dem British Museum in London, kommen für sie also nicht in Frage.
Ihre Doktorarbeit hat „die Entwicklung der Gottheit LAMA auf Rollsiegeln im Syrien des zweiten Jahrtausends v. Chr.“ zum Thema. Ganz besonders reizt Zena an dieser fürbittenden Gottheit, die als Bindeglied zwischen Anbetern und Göttern dient, dass es noch keine konkrete Definition für sie gibt. Außerdem möchte sie herausfinden, warum LAMA immer als weibliche Gottheit dargestellt wurde.
Wann denn ihr Entschluss gereift wäre, Archäologie zu studieren, will Silke wissen, und Zena offenbart, dass man kaum von einem Entschluss sprechen könne. „Ich war schon immer interessiert an vorderasiatischer Archäologie und verliebt in die Mythologie. Schon in der Schule wusste ich, dass ich Archäologie studieren werde.“
Zena hat eindeutige Vorstellungen, und im folgenden Gespräch hat sie auch ziemlich eindeutige Antworten. Die Frage, ob sie sich eine Rückkehr nach Syrien vorstellen kann, wird wohl am eindeutigsten beantwortet: „Wenn unsere Generation nicht zurückgeht, wer dann?“, sagt sie und erzählt von einem syrischen Professor, der mittlerweile am Pariser Louvre arbeitet und am ersten Aprilwochenende an einem Archäologenkongress in München teilgenommen hat. „Wenn eure Generation nicht zurückgeht, wer soll dann Syrien wieder in Ordnung bringen!“, hat er Zena und Raaed auf dem Kongress bestärkt. Und genau das ist auch ihr Plan. Wieder zurückgehen nach Syrien und aktiv am Wiederaufbau mitzuhelfen. Vor allem am Wiederaufbau und der Rekonstruktion zerstörter historischer Stätten.
Das klingt hoffnungsvoll, aber auch utopisch.
„Wenn man sich all die Fotografien anschaut, zum Beispiel die von Palmyra, da ist ja alles total zerstört. Ist es überhaupt möglich, diese Stätten jemals zu rekonstruieren, oder ist es nur ein Traum?“, fragt dann auch eine junge Frau aus dem Publikum und Silke Kleemann setzt nach, inwieweit man vollständig zerstörte historische Stätten, selbst wenn sie nach historischem Vorbild wieder errichtet werden, überhaupt als authentisch betrachten kann.
Doch wo Raaed zu Beginn des Gesprächs hat anklingen lassen, dass er sich und Zena in München bisher zu wenig bei ihrem Projekt unterstützt sieht, vermitteln die beiden nun ungebrochenen Optimismus: Sehr viele Archäologie-Studenten (in aller Welt), nicht nur syrische, säßen gerade an ihren Doktorarbeiten, ständen vor dem Abschluss. Ihre Mission sei es, beim Wiederaufbau zu helfen. Schon heute kooperierten syrische Wissenschaftler miteinander: die, die Syrien verlassen haben, und die, die noch dort leben. Schon heute gäbe es an deutschen Unis Projekte, bei denen syrische und deutsche Studenten den Wiederaufbau von beispielsweise Aleppo mitplanen. Und natürlich müsse man sich Zeit nehmen und Schritt für Schritt vorgehen. Nach Syrien fahren, den Zustand der Zerstörung genau dokumentieren, vorliegende Pläne studieren, neue Pläne erstellen, rekonstruieren.
Karin Berner von der Kultur- und Kunstvermittlung des Museums Fünf Kontinente, auch sie sitzt im Publikum, gibt zu verstehen, wie angetan sie von dem geplanten Ausstellungsprojekt ist, gleichzeitig aber äußert sie Bedenken: Wie wollen Zena und Raaed verhindern, dass die Vorher-Nachher-Methode Besucher, gerade vielleicht auch syrische, womöglich sogar auch traumatisierte Besucher, nicht in Verzweiflung oder gar Depression verfallen lasse? Was wollen sie dieser Dokumentation noch an positivem Ausblick hinzufügen? Natürlich könne man es nicht nur beim Vorher-Nachher belassen, meint Zena. Die Dokumentation der einstmals intakten und nun zerstörten Stätten sei enorm wichtig, wichtig sei aber auch, einen Schritt weiter zu gehen à la „Wir hatten etwas Großartiges, jetzt ist es zerstört, nun müssen wir alle optimistisch sein.“ Sehr viel konkreter werden Zena und Raaed in diesem Punkt an diesem Abend nicht; auf Nachfragen des Publikums klingt noch an, dass die geplanten Dokumentarfilme eine Neuzusammenstellung von Dokumentationen historischer Stätten vor dem Bürgerkrieg und Aufnahmen während des Bürgerkriegs sein könnten. Und dass die geplanten 3D Modell-Konstruktionen einiger zerstörten Stätten tatsächlich eine Hoffnung oder zumindest eine Vorstellung von einem „Weiter“ vermitteln könne.
Zwei Tage nach diesem beeindruckenden, gleichzeitig erschütternden und hoffnungsfrohen Abend werden Amerikaner, Briten und Franzosen Luftangriffe auf Syrien fliegen, in deren Folge die Frage gestellt werden wird, wie berechtigt diese Angriffe waren. Erneut wird auch wieder die Notwendigkeit einer politischen Lösung bekräftig werden. Und Frankreichs Staatspräsident Macron wird eine neue diplomatische Initiative in Syrien ankündigen. Nicht nur in der internationalen Staatengemeinschaft, nicht nur auf Regierungsebene, nicht nur als Politiker wird man sich fragen, wie es jetzt eigentlich weiter gehen soll, kann oder muss. Wer am 12. April im Münchner Museum Fünf Kontinente zu Gast war, wird sich dann an diesen Abend zurückerinnern und sich im Rückblick darüber freuen können, wie hoffnungsvoll und gleichzeitig konkret er dann doch war.
Weitere Eindrücke des Abends



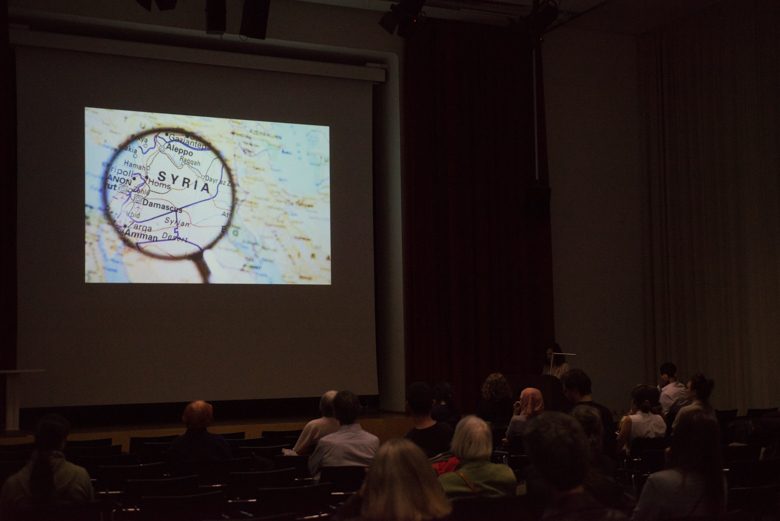



Exil nicht nur als Tragödie, sondern als Chance?
Bei der 49. Meet your neighbours Veranstaltung sprach die Berliner Schriftstellerin Svenja Leiber am 14. April im Museum Europäischer Kulturen mit vier der arabischen Frauen, die Heike Steinweg in ihrer Ausstellung „Ich habe mich nicht verabschiedet | Frauen im Exil“ porträtiert. Sie alle teilen den Mut, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen.
Text: Marie Krutmann
Mit Fotografien von Alexander Janetzko

In Heike Steinwegs Ausstellung „Ich habe mich nicht verabschiedet | Frauen im Exil“ wird die Kunst zum Betrachter. Von allen vier Seiten des Raums blicken mir die Gesichter verschiedener Frauen entgegen. Stühle in der Mitte des Raums laden dazu ein, in ihrem Kreis Platz zu nehmen. Um eines der Porträts genauer zu betrachten, muss man aufstehen und auf das lebensgroße Bild der jeweiligen Frau zugehen. In gewisser Weise wird das Thema der Meet your neighbours-Gesprächsrunde somit bereits auf räumlicher Ebene verhandelt. Wir teilen uns einen Raum und kommen einander näher, indem wir aktiv auf die Frauen zugehen, anstatt sie aus der Ferne zu beobachten.
Wie zur Bestätigung dieses Eindrucks eröffnet Annika Reich von WIR MACHEN DAS die Veranstaltung mit einem Anliegen. Bei den Begegnungen der Meet your neighbours-Reihe gehe es darum, zu zeigen, dass wir die Welt teilen können und wollen. Um eine gemeinsame Begegnung auf Augenhöhe zu schaffen, müsse man jedoch lernen, einander ohne Stigma zu betrachten. „Ohne all das, was den Menschen, die wir sehen, bereits passiert ist“, erklärt Heike Steinweg, die gemeinsam mit Dr. Irene Ziehe, der stellvertretenden Museumsdirektorin, das Publikum und die Gäste auf dem Podium willkommen heißt:
„Mir ist es von Anfang an wichtig gewesen, dass die Frauen an dem Projekt aktiv beteiligt sind, dass sie sich in ihren eigenen Worten äußern können und über Themen sprechen, die ihnen am Herzen liegen. Den Blick nach vorne gerichtet, auf ihre Wünsche und Hoffnungen, auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Exils.“

Vier dieser Frauen sind Hend Al Rawi, Arwa Almoadhen, Lama AL Haddad und Lina Al Haddad, die an diesem Nachmittag mit Svenja Leiber über ihr Leben im Exil sprechen. Als sie die vier darum bittet, sich dem Publikum vorzustellen, greift Hend zum Mikrofon und verkündet, sie würde ihre Antwort gerne auf Deutsch versuchen. Wir erfahren, dass Hend in ihrer Heimat Damaskus als Englischlehrerin gearbeitet hat. Seit 2015 lebt sie in Berlin, wo sie bei der Cisco Networking Academy arbeitet, genau wie ihre Sitznachbarin Arwa aus dem Irak, die in Bagdad als IT-Professorin tätig war. Auf das darauffolgende Raunen im Publikum erwidert Arwa lächelnd, dass MINT-Berufe für Frauen im Irak etwas ganz Normales seien.
Als ich Arwa zuhöre, kommen mir Heike Steinwegs einleitende Worte in den Sinn: „Viele dieser Frauen bringen andere Normalitäten mit, von denen wir noch einiges lernen können.“ Mit Stolz hatte sie von den sehr persönlichen Begegnungen bei ihrem Fotoshooting berichtet. Exil nicht nur als Tragödie, sondern als Chance? Diese Chance bezieht sich nicht allein auf das Schicksal der Frauen, die im Exil leben. Auch wir, das (überwiegend weibliche) Publikum, können von dieser Erfahrung profitieren.

Jede Geschichte ist einzigartig und Exil bedeutet für jede etwas anderes
„Ich genieße das Leben hier, ich genieße sowohl die Herausforderungen und den Stress, die damit verbunden sind, als auch die Autonomie, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, die ich Schritt für Schritt erreiche. Ich nehme nichts als gegeben an, sondern erinnere mich immer daran, dass nichts für immer bleibt. Und dass ich aus dem, was ich habe das Beste machen muss.“
So steht es unter dem Porträt von Lama, die an diesem Nachmittag als Übersetzerin neben ihrer Schwester Lina auf dem Podium sitzt. Lama hat ihre Heimat Syrien vor 5 Jahren verlassen. Als der Krieg in Syrien ausbrach, schickten ihre Eltern sie nach Süddeutschland zu ihrem Onkel, der seit 30 Jahren dort lebt und für sie bürgte. Inzwischen lebt Lama in Berlin, wo sie ihren Master in Englischer Literatur absolviert. Ihre Schwester Lina studierte in Japan Psychologie, bevor es sie ebenfalls nach Berlin verschlug. Dass die beiden Schwestern heute gemeinsam in einer Stadt und in einem Land leben, ist Zufall. „Das Wort Exil verfügt über eine große historische Dimension“, schildert Svenja Leiber ihre Überlegungen. Ihm haften vorwiegend negative Assoziationen wie Krieg, Flucht und Verbannung an. Aber nicht alle Geschichten, die mit dem Exil in Verbindung stehen, sind Fluchtgeschichten. „Ich bin Migrantin, aber ich bin aus einem sicheren Land hierhergekommen“, bestätigt Lina ihr. „Wir kommen in allen möglichen Variationen, wir sind alle anders!“ Und nicht jede hatte wie sie die Möglichkeit, sich bewusst für ein Leben im Exil zu entscheiden.


Wie um daran zu erinnern, hängt hinter den vier Frauen auf dem Podium das Porträt einer Frau, die der Kamera ihren Rücken zuwendet. Wie wir von Heike Steinweg erfahren, war die Porträtierte beim Auswärtigen Amt eingeladen, um über Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land zu berichten, im Falle einer Rückkehr in ihre Heimat droht ihr die Verhaftung. Von ihr stammt das titelgebende Zitat der Ausstellung: „Ich habe mich nicht verabschiedet.“ Um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, das eigene Zuhause für immer zu verlassen, braucht sie ihr Gesicht nicht der Kamera zu zeigen. Genauso wenig spielen ihre Hautfarbe, Nationalität oder Religion eine Rolle, wenn es darum geht, ihre Gefühle mit anderen zu teilen. Unter ihrem Porträt steht:
„Mein Name spielt keine Rolle. Ich bin ein Mensch. Mein Gesicht ist wie eine Leinwand, auf der ihr euch alle Gesichter vorstellen könnt, die jemals von Leid und Sehnsucht gezeichnet wurden. Meine Haut hat die Farbe aller Menschen zusammen. (…) Ich möchte, dass ihr die Tiefe meiner Traurigkeit versteht: Ich kann nicht zurück in mein Land, und ich habe mich von meiner Familie nicht verabschiedet, weil ich nicht wusste, dass es ein Abschied für immer war.“
Es gehe darum, eine eigene Position einzunehmen. Die Frauen wählten ihre Haltung und die Kleidung, in der sie sich fotografieren ließen, selbst und konnten sich auf diese Weise aktiv auf die Situation vorbereiten. Heike sagt: „Zeig deine Stärke, lächle nicht, versuch nicht süß auszusehen“, berichtete Lina von ihrem Fotoshooting. Dabei habe sie sich gefragt, ob sie tatsächlich stark sei. Wenn sie an ein Fotoshooting dachte, kamen ihr glamouröse Kleider und Make-up in den Sinn. „Das perfekte Bild.“ Als Heike sie fotografierte, befand Lina sich jedoch in der schlechtesten Phase ihres Lebens. In Japan hatte sie ein „ganzes Leben“, ihre Lieblingsorte und Freunde gehabt. In Berlin hatte sie all das verloren – wie sollte sie da eine starke, kraftvolle Pose einnehmen? Vielleicht hatte sie es gar nicht verdient, fotografiert zu werden. Da fiel ihr ein, dass sie im Rahmen ihres Psychologiestudiums gelernt hatte, dass Frauen häufig dazu neigen, über ihre Umgebung und die Stärken anderer, anstatt über sich selbst, zu sprechen. Als Heike sie fotografierte und darum bat, für ihren Katalog einen Text zu schreiben, bestand Linas größte Herausforderung darin, sich einzig und allein auf sich zu beziehen. Selbstermächtigung bedeutet für sie, in der Lage zu sein, an die eigene innere Stärke zu glauben – „selbst dann, wenn man in der schrecklichsten Situation steckt.“ Zum Beweis richten sich nun alle Blicke auf ihr Porträt an der gegenüberliegenden Wand. Darauf ist Lina zu sehen, in einem gemusterten Kleid, über dem sie einen schwarzen Cardigan trägt. Die Nägel, der mittig aneinandergelegten Daumen, rot lackiert, das lange Haar nach oben gebunden. Ihr Blick fragend, weder süß noch schwach.
Starke Frauen, die für ihre Rechte kämpfen
Dass es wenig Sinn hat, sich auf die bestehenden Probleme zu fixieren, musste auch Arwa feststellen. Bevor sie nach Berlin kam, hatten Arwa, ihr Mann und ihr kleiner Sohn bereits in drei verschiedenen deutschen Städten gelebt. Um eine Zukunft für sich und ihre Familie zu schaffen, hat sie jede Ungewissheit auf sich genommen und stets wieder bei Null begonnen. Selbstermächtigung bedeute auf der einen Seite, sich selbst in den Fokus der Kamera zu rücken. Für Arwa bedeutet es aber ebenso, selbst aktiv zu werden. Anstatt sich in der Rolle des Opfers zu sehen, beschloss sie, sich ein Beispiel an den deutschen Frauen zu nehmen, die ehrenamtlich in ihrem Wohnheim arbeiteten. „Ihr Engagement hat mich inspiriert, ich wollte auch helfen.“ Arwa beschloss auf ihre Erfahrungen zurückzugreifen und Computer-Workshops für Frauen in ihrem Wohnheim anzubieten, damit sie die Möglichkeit erhalten, sich einen Job zu suchen.
„Inwiefern bedeutet Frausein politisch zu sein?“ Mit dieser Frage verweist Svenja Leiber auf ein Jubiläum, dass dieses Jahr in Deutschland gefeiert wird: 100 Jahre Suffragetten. Während für deutsche Frauen seit Jahrzehnten die Möglichkeit besteht, wählen zu gehen, verfügt keine der vier Frauen neben ihr über ein Wahlrecht. „Ich habe keine politische Stimme, ich darf weder in Syrien noch in Deutschland wählen“, so lautet auch das Statement unter dem Bild von Rasha Abbas.

„Die Frauen hier in Deutschland sind sehr stark“, stellt Hend dem gegenüber auf Arabisch fest. Das sei eine der ersten Beobachtungen gewesen, die sie in Berlin gemacht habe. Die Frauen hier bringen ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Kita, fahren anschließend zur Arbeit, holen am Nachmittag die Kinder wieder ab und bringen sogar noch Zeit für soziales Engagement auf. Über die Gemeinschaft von WIR MACHEN DAS habe sie Ärztinnen, Anwältinnen und Künstlerinnen kennengelernt, die ihre Hilfe bei Behördengängen und Übersetzungen anboten. Dann habe sie diese Frauen mit den Frauen in ihrer Heimat verglichen. „Frauen in der arabischen Welt sind schwach.“ Doch das liege nicht an ihnen, sondern an der mangelnden Unterstützung von Seiten des Staates. In Syrien sei es ungewöhnlich für eine Frau, Fahrrad zu fahren. Hend und einige andere Frauen haben aus diesem Grund damals eine Bewegung ins Leben gerufen, um genau das zu ändern. Als diese Worte das Publikum in der Übersetzung erreichen, bricht Applaus aus. Doch all die scheinbaren Erfolge ließen kein Ende ihres Kampfes erkennen, führt Hend ihren Gedanken weiter aus. Nach zwei Jahren in Deutschland habe sie ernüchtert feststellen müssen, dass Frausein – egal an welchem Ort – immer kämpfen bedeutet. „Du denkst, wir hätten alles erreicht?“, hatte eine deutsche Freundin sie gefragt. „In Deutschland verdienen die meisten Frauen noch immer deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen oder bekommen keine höheren Jobpositionen angeboten, da sie ja schwanger werden könnten.“
„Wie gehören Migration und Emanzipation zusammen?“, fragt Svenja Leiber mit der Aufforderung an das Publikum, sich diese Frage einmal selbst zu stellen. Man denke allein an die vielen Märchen, die uns lehren, dass das Hinausgehen in die Welt Voraussetzung für die eigene Entwicklung und Emanzipation sei. Wie kann es da sein, dass vier so kluge Frauen unter uns sitzen und keine politische Stimme haben?
„Wenn die Gesellschaft und ihre Gesetze mich nicht unterstützen, dann muss nicht ich mich ändern, sondern sie sich“, erklärte Lina daraufhin in festem Ton. Sie erinnere sich noch gut daran, wie sie anfangs in Berlin geduckt in der S-Bahn gesessen habe, weil sie sich klein und unbedeutend gefühlt habe. Heute weiß sie, dass sich nur dann etwas ändern kann, wenn sie selbst an sich glaubt: „Du musst an deine eigene Größe glauben!“ Und doch fragt sie sich oft, was die Leute sehen, wenn sie ihr begegnen. Sehen sie eine Frau? Oder sehen sie eine Migrantin? Wie um diese Frage zu beantworten, meldet sich eine Frau aus dem Publikum zu Wort, und erzählt, dass sie mit 17 Jahren aus Palästina nach Deutschland gekommen sei, um hier als Cellistin zu arbeiten. Ein Professor habe ihr deutlich gemacht, dass sie in ihre Heimat zurückkehren solle, wenn sie sich für etwas Besonderes halte. Dabei sei sie einfach eine 25jährige Cellistin – nichts anders. „Wir wollen einfach nur Respekt und überleben.“

Exil nicht nur als Tragödie, sondern als Chance? Wie kann die Zukunft dieser Frauen aussehen? Die abschließende Frage kommt aus dem Publikum, in dem auch Hends Mutter sitzt. Sie fragt: „Wo seht ihr euch in den nächsten 3 Jahren?“ Eine Frage, die mich an ein Vorstellungsgespräch erinnert. Ähnlich lautet auch die Antwortvon Arwa. Sie wünsche sich einen stabilen Job, schiebt dann aber in einem Nebensatz nach: „Vielleicht habe ich in drei Jahren sogar eine eigene Wohnung.“ Auch Hend will sich auf ihre Karriere konzentrieren (was soll sie auch sagen, wenn die eigene Mutter fragt). Derzeit suche sie aber noch nach einem Praktikumsplatz in einer Kita oder Schule. Wenn alles gut laufe, könne sie dann mit 40 ihre Ausbildung beginnen, fügt sie lachend hinzu – wissend um die Absurdität dieser Aussage. Lama und Lina hoffen beide, dass sie in drei Jahren ihren Uni-Abschluss haben. Beide wollen sich auch in Zukunft sozial engagieren, wobei Lina sich durchaus auch eine Karriere als Bundeskanzlerin vorstellen kann. Als das Lachen im Publikum abklingt, erwidert Hend: „Ich werde dich wählen, Lina – wenn ich bis dahin wählen darf.“

„Wir sind hier“ Buchpremiere in der Monacensia, München
Das Buch „Wir sind hier. Geschichten über das Ankommen“ versammelt die individuellen Erfahrungen von 38 internationalen AutorInnen. Die Premiere der von Katja Huber, Silke Kleemann und Fridolin Schley herausgegebenen Meet Your Neighbours-Anthologie in der Münchener Monacensia war ein Fest.
Text: Andreas Unger
Foto: Verena Kathrein

Als ich auf den Beginn der Buchpremiere von „Wir sind hier – Geschichten über das Ankommen“ in der Monacensia wartete, konnte ich mir die Buchtitel und Namen von Münchner Autoreninitiativen der letzten Jahre in Erinnerung rufen. Sie zeichnen den Weg von der Ankunft der ersten Geflohenen am Münchner Hauptbahnhof bis ins Jetzt nach.
Es begann mit der Anthologie mit dem schroffen Titel „Fremd“, herausgegeben von Fridolin Schley, in der der Leser Fremdheit als etwas Universales kennenlernte: Fremdsein war plötzlich nicht nur den Angekommenen zueigen, sondern rückte näher, wurde gar zu einer Vertrauten. Dann erschien die Textsammlung „Die Hoffnung im Gepäck“ – das klang vielversprechender, einladender, zukunftsgewandt. Ungefähr zur selben Zeit schlossen sich Münchner Autoren dem Projekt Meet Your Neighbours an.

Hier war Pragmatismus am Werk, hier sollte nicht nur gedacht und geschrieben, sondern gehandelt werden, und zwar durch Denken und Schreiben. Neu zugezogene und alt-Münchner Lyrikerinnen, Übersetzerinnen, Dramaturgen und Autoren lasen in Münchner Buchhandlungen, berichteten von ihren Plänen, suchten Kontakte zu hiesigen Verlagen oder waren dabei, selber welche zu gründen, mischten sich unter die Leute. Den nächsten, gewissermaßen folgerichtigen Schritt beschreibt nun der matter-of-fact-hafte Buchtitel „Wir sind hier“: Erste Person Plural, Indikativ, Präsens. Subjekt, Prädikat, Objekt. Basta.
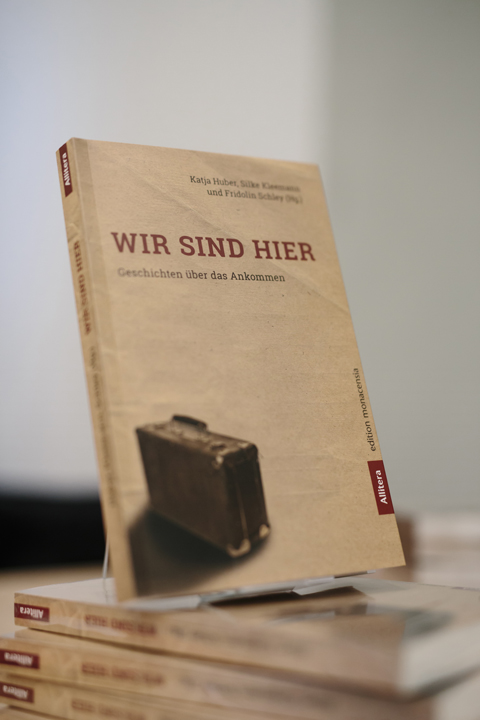
38 Autoren aus über einem Dutzend Ländern stellen sich und den Lesern Fragen und tun nicht so, als hätten sie eindeutige Antworten auf Fragen wie: Muss man sich für einen neuen Lebensort von der alten Heimat lösen? Kommt man jemals ganz an?
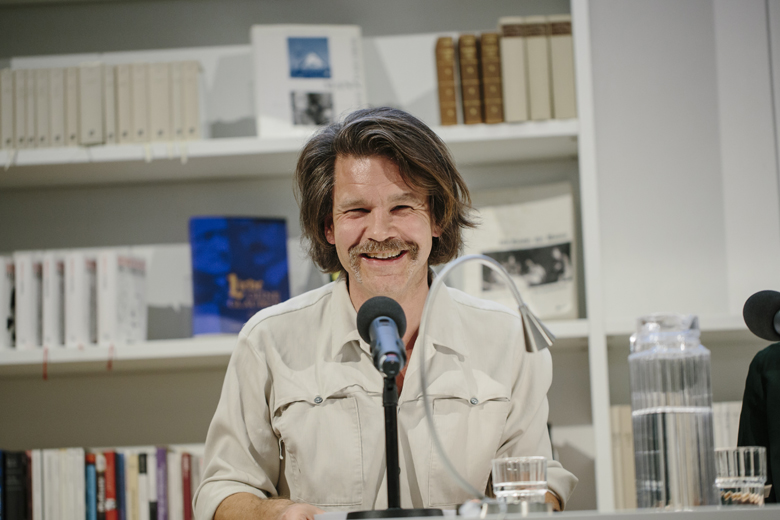
Martin Lickleder sagte einführend, er wisse nicht, wie gut sein Text sei. „Vorlesen lässt er sich beschissen“, schickte er noch vorweg, um sich dann mittels Vorlesens selbst zu korrigieren. Er schrieb über die Liedform und darüber, dass es nicht darauf ankomme, was hinten rauskommt, sondern was dazwischen passiere, denn das Lied kehre ohnehin wieder zur Tonika zurück..Zum Beispiel bei People Get Ready von den Impressions: „Doch dann, in der vierten Zeile, öffnet sich völlig unvermittelt der Himmel: Das Lied schießt in das glorreich hellblaue e-Moll 7 empor, gewährt im Sinkflug auf das majestätische d-Moll 7 einen göttlich schwerkraftbefreiten Blick über die Herrlichkeit der Schöpfung und zwar zu der großartigen, weil gesellschaftliche, juristisch ökonomisch Fesseln konkret und mit der doppelten Verneinung des afro-amerikanischen Slang Idioms benennenden Zeile: Don’t need no ticket …“ Zum Nachhören: https://www.youtube.com/watch?v=l04yM7-BWbg



Besser lässt sich das nicht beschreiben, höchstens singen, weshalb Lickleder und seine Mitmusiker Reza Pezeshki und Martin Pflanzer umgehend bewiesen, dass man die Tonika gar nicht allzu oft allzu weit hinter sich lassen musste, um eine große Reise zu tun. Was einem vielleicht sogar, auf der Rückreise, einen versöhnlichen Blick auf die bayerischste aller Tautologien gewährt: dahoam is dahoam. Mit dabei: die Sängerin Ayeda Alavie, die auch als Autorin schon mehrere Veranstaltungen von Meet Your Neighbours bereichert hat.

Heike Geißler fordert in ihrem Text „Zeit für Zauberer“: „Wir brauchen eine Schule der Solidarisierung. Eine Schule des Mitgefühls. Nicht nur des Mitgefühls für Geflohene, für alle. Wir brauchen auch einen stärkeren Protest, eine Protestroutine. Einen in den Alltag integrierbaren Protest. Schaut man sich die Welt an, darf der Protest kein Sonderfall sein.“

Barbra Breeza Anderson, eine aus Simbabwe stammende Modedesignerin, Lyrikerin und Bloggerin, erzählt in ihrem Gedicht „Alte Düfte von Zuhause“ von ihrer Suche nach dem Vertrauten in der neuen Umgebung:
Suche etwas Normales an einem Ort
wo meine alten Symbole neue Bedeutungen haben
und meine Erinnerungen sich weit durch die Zeit erstrecken.
Dabei hoffe ich die ganze Zeit, dass bald
neue Düfte die alten Düfte von Zuhause werden.

James Tugume lebte als Kind drei Jahre lang in Kampala auf der Straße, arbeitete als Marktverkäufer und wusste morgens oft nicht, wo er nachts schlafen würde. „In der ganzen Zeit hatte ich aber nie das Gefühl, dass mir etwas fehlte oder dass ich Probleme hätte.“ Mittlerweile hat ihn die Liebe nach Deutschland geführt. In ein gefährliches Land: „In den zwei Jahren hier in München hatte ich immer das Gefühl, sehr vorsichtig sein zu müssen, weil es überall gefährlich ist: elektrische Autos, die ich nicht höre, Fahrräder, die rücksichtslos fahren, aggressive Leute auf der Rolltreppe, die links überholen wollen, überall komplizierte Regulierungen, die ich nicht immer verstehe.“

Die türkischstämmige Journalistin Banu Acun wartete mit einer Premiere auf, ihrer ersten deutschsprachigen Veröffentlichung. Sie erklärte den Bio-Deutschen, wie türkischstämmige Deutsche von den Türken wahrgenommen werden. „Almanci“, „Deutschländer“, so heißen sie, es wird vielerorts auf sie herab gesehen: darauf, wie sie ihren in Deutschland erarbeiteten Wohlstand in der alten Heimat zur Schau stellen. Und man mokiert sich über das Türkisch der in Deutschland geborenen, das nicht mehr fließt, sondern ruckelt. Die deutschen Hörer staunen und verstehen plötzlich, dass den so genannte Deutschtürken nicht nur in Deutschland ein Integrationsproblem zugeschrieben wird.

Von zwei Ankommern erzählt Angelica Ammar in „Hier ein Meer, dort eine Fabrik“: von Momar und der Ich-Erzählerin, die an folgender Stelle mit einer großartigen Nebensächlichkeit abgetan wird: „Ich war in Barcelona angekommen, wie man als Europäer eben ankommt. Ich hatte mir eine Wohnung genommen, meinen Computer auf einen Schreibtisch gestellt und weitergearbeitet. Ich hatte ein Kind bekommen, ging mit ihm zum Strand, dem großen Spielplatz der Stadt, und flog in den Ferien quer durch die Weltgeschichte.“ Momar dagegen war über Dakar, Marrakesch nach Barcelona gereist, hatte sein Glück als Straßenverkäufer versucht und nicht gefunden, hatte nebenbei Spanisch und Katalanisch gelernt und die Ich-Erzählerin gefragt: „Warum machst du das?“ Die überlegt: „Wie sollte man erklären, was man für sich selbst nicht in Worte fassen wollte. Das Privilegiertsein. Dass einem all diese Dinge nicht zustoßen konnten, mit denen Momar und die anderen sich tagtäglich herumschlagen mussten. Dass ich mir vermutlich nie in einer leer stehenden Fabrik ein Kabuff bauen würde.“

Es war ein Abend ohne Schlusswort und ohne Moral von der Geschicht – gut so.
Die Anthologie „Wir sind hier. Geschichten über das Ankommen“ mit 38 internationalen Autorinnen und Autoren ist im Nachgang des Festivals Acht Mal Ankommen entstanden, an dem auch das Literaturportal Bayern als Kooperationspartner beteiligt war.
Veranstalter: Monacensia im Hildebrandhaus, Allitera Verlag und WIR MACHEN DAS. In Zusammenarbeit mit der Allianz Kulturstiftung und der Stiftung :do
Meet You Neigbours in Stralsund
Migrantische und deutsche Erzieher*innen sprechen über ihre berufliche Praxis.
Mit dabei sind Fatima Aldibo, Salwa Iskaf, Naya Fahd, Kristina Kowalski-Schöning, Doreen Rudolph, Daniel Sättler, u.a.
Moderation: Jana Michael (tutmonde e.V.)
Stadtbibliothek Stralsund Badenstraße 13, 19.00 Uhr
Das Projekt Meet Your Neighbours bringt in Nachbarschaftsgesprächen Migrant*innen und deutsche Menschen aus verschiedenen Arbeitsfeldern in Gesprächen über ihre Berufe zusammen. Im Mittelpunkt des Abends in Stralsund steht dieses Mal der Erzieher*innenberuf, nachdem hier im Dezember schon Journalistinnen diskutiert haben. Neu zu uns gekommene Erzieherinnen tauschen sich mit deutschen Kolleg*innen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer beruflichen Praxis in Syrien, Serbien und Deutschland aus. Nicht mehr Geschichten von Flucht und Gewalt stehen im Vordergrund, sondern die berufliche Identität! Persönliche Motivationen, Erfahrungen, Interessen und schließlich auch die Probleme, die die Ausübung des gelernten und geliebten Berufs in Deutschland erschweren, werden thematisiert.
Die Veranstaltungen der Meet Your Neighbours Reihe finden statt in Zusammenarbeit mit der Allianz Kulturstiftung, dem Fonds Soziokultur und der Stiftung :do. In Stralsund außerdem in Kooperation mit Tutmonde e.V., DaMigra sowie dem Verein Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern e.V.




